@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 0cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }
pre { font-family: "Liberation Mono", monospace; font-size: 19pt; background: transparent }
joedis hobby-Fotobuch 1-J-111.2.3m1c1K5AWZ-c2Y-main1.html
doc.last.modif:
Da das html-Dokument ziemlich gross ist, kann das Starten des Browsers eventuell ein wenig dauern...
www.joedineck.de präsentiert:

Tipps und Tricks für Digitalkameras
-Ein Erfahrungsschatz mit vielen Beispielen -
(c) by "joedi" Jörn Jacobs, Edingen-Neckarhausen, 2021/2022/2023
Anmerkung:
Dieser Text und alle enthaltenen Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Der Text enthält nur meine persönlichen Ansichten, und verfolgt keinerlei kommerzielle Absichten. Er darf für wissenschaftliche- und Ausbildungszwecke zitiert werden, darf aber in keiner anderen Form publiziert werden.
Wo Personen auf Fotos erkennbar abgebildet erscheinen, geschieht dies mit deren Zustimmung. Bilder älter als etwa 20 Jahre gelten als nicht mehr erkennbar.
Noch eine Anmerkung: DIESER TEXT IST GANZ KLAR NOCH NICHT ENDGÜLTIG UND KANN FEHLER ENTHALTEN
Note:
This text is, and all photographs herein are, copyrighted material. It reflects my personal views only, and doesn't have any commercial intention whatsoever. It may be quoted for scientific or educational purposes, but must not be republished in any form.
Where persons appear identifiably on the images, this is with their consent.
Photographs older than some 20 years are considered unidentifiable throughout.
yet another note: THIS IS DEFINITELY A NON-FINAL VERSION AND MAY CONTAIN ERRORS!
Technische Anmerkung:/ Technical note:
Die vorliegende Version ist ein einfacher Satz von html-Dokumenten, und zum Ansehen mittels eines web-browsers gedacht. Sie hat keine Seitenstruktur, und ist für das Ausdrucken nicht geeignet. Da die html-Dokumente ziemlich gross sind, kann das Starten des Browsers eventuell ein wenig dauern...
The version in front of you is a simple set of html documents, to be viewed by a web browser. It doesn't have a page structure and is not suited for printout. The html documents being fairly large, the browser startup may take a while...
Zu den Textfarben:
Die technischen Texte erscheinen in schwarzer Schrift, z.B. Teleobjektive.
Der inhaltlich-gestalterische Teil hat diese Textfarbe:
Motive,
ein Bildteil der Fotomotive namens "Gute Bilder".
Kapitel und Unterkapitel sind (meistens (:-)) ) alfabetisch angeordnet.
Und: Ganz wichtig: Danksagung an alle, die meine Fotoleidenschaft mitgetragen ("ausgehalten") haben
und besonders auch an Jens für die unzähligen Fachgespräche! Nun aber:
Viel Freude beim Anschauen!
Anfang
Vor 70 Jahren war ich natürlich noch kein Hobbyfotograf; aber nahe dran: Ich
besass eine sogenannte "Box" der Marke Bilora, Rollfilm Typ "120" mit Platz für 8 Aufnahmen 6 mal 9 cm,
Blende 11 und 16, Verschluss "Moment" (ca. 1/25 s) und B (beliebig). Sie
hatte sogar einen Blitz-Anschluss. "Ausbildung" zum Hobbyfotografen begann also mit dieser Box, und von da ab
so nebenbei mit diversen Kameras, siehe Abschnitt "Meine alten Kameras". Real gearbeitet habe ich dann aber als Elektronik- und
Telekommunikationsingenieur und ein wenig als Sprachwissenschaftler. Musik und seit einiger Zeit
Komposition ist auch noch zu nennen. Doch zurück zur Fotografie und damit zu meinen persönlichen Foto-Hobby-Erfahrungen, die ich jetzt erzählen möchte:
Alte Objektive an neueren Kameras
Bild 1
 Als Überbleibsel von alten Spiegelreflexkameras ("SLRs") habe ich noch
einige Objektive mit M 42- und PK-Anschluss.
Darunter Raritäten wie ein echtes Tessar Zeiss Jena DDR oder ein
1,3 kg schweres Zoomobjektiv Universa 1:4,5/ 70-230, Bild 2.
Als Überbleibsel von alten Spiegelreflexkameras ("SLRs") habe ich noch
einige Objektive mit M 42- und PK-Anschluss.
Darunter Raritäten wie ein echtes Tessar Zeiss Jena DDR oder ein
1,3 kg schweres Zoomobjektiv Universa 1:4,5/ 70-230, Bild 2.

Einige habe ich allerdings
auch auf Fotobörsen noch dazugekauft (:-))). Meine heutigen digitalen Spiegelreflexkameras ("DSLRs") haben den Canon-
EF-Anschluss. Das ist eine günstige Kombination, denn Adapter für den
Übergang M42 auf EF sind mechanisch recht einfach zu realisieren und werden in grosser
Zahl angeboten. Natürlich sind diese Objektive nur manuell verwendbar, also:
- nötigenfalls Kamerabetrieb "ohne Objektiv" erlauben
- alles über Autofokus vergessen
- den Modus "Av" (bei Lumix heisst er "A") wählen. Hierdurch arbeitet
die Kamera für die Belichtung in "Zeitautomatik".
- Blendenwert- und Entfernunggseinstellung nun von Hand vornehmen.
Sie werden erstaunt sein, wie gut und schnell das geht !
Neu gekauft habe ich ein Samyang = Walimex 8mm Superweitwinkel,
das ohnehin nur manuell einstellbar ist.
Bei all diesen "unpassenden" Objektiven ist zu bedenken: An meinen Canon-DSLRs (20D,50D,300D) gilt der crop-Faktor
1,6, also: Freude über das entsprechend stärkere Tele-, und Missmut über das
entsprechend geringere Weitwinkelverhalten. Näheres sie im Abschnitt
"crop-Faktor".
Auch der Übergang von M42 oder PK auf MFT ist kein Problem. Meine Lumix G3
(mit dem crop-Faktor 2) habe ich recht günstig für 90€ gebraucht gekauft, und dazu Adapter
M42 auf MFT und Canon EF auf MFT. Für die bei mir selteneren Alt-Objektive mit PK-Anschluss wird erst in
Canon EF, und dann in MFT gewandelt. Die Lumix G3 hat bei mir übrigens lange Zeit kein
passendes MFT-Autofokus-Zoom-Whatsoever-Objektiv gesehen, wohl aber diverse
Tele- und Superweitwinkelobjektive; und ab und zu für "normale" Fälle ein
M42-3:5/28mmm, wenn es mal ein "normaler" Bildausschnitt werden sollte. Getestet
habe ich natürlich auch diverse Probe-Kombinationen, und dies mit einem enormen, sofortigen Lerneffekt, da
man auf dem Display=Sucher ja sofort alles sieht, was sich optisch tut, dies dann vergrössert ansehen kann usw.
Noch eine Rarität: Ein ohnehin halbdefektes (schade drum ...) altes Objektiv Schneider
Kreuznach Edixa-Xenon 2.8/50 habe ich seiner Iris-Blende beraubt und eine feste
Blende (ca. 1/5.6) in Herzform eingebaut. Fotobeispiele für dieses "Bokeh" in
Herzform siehe unten.
Bild 3
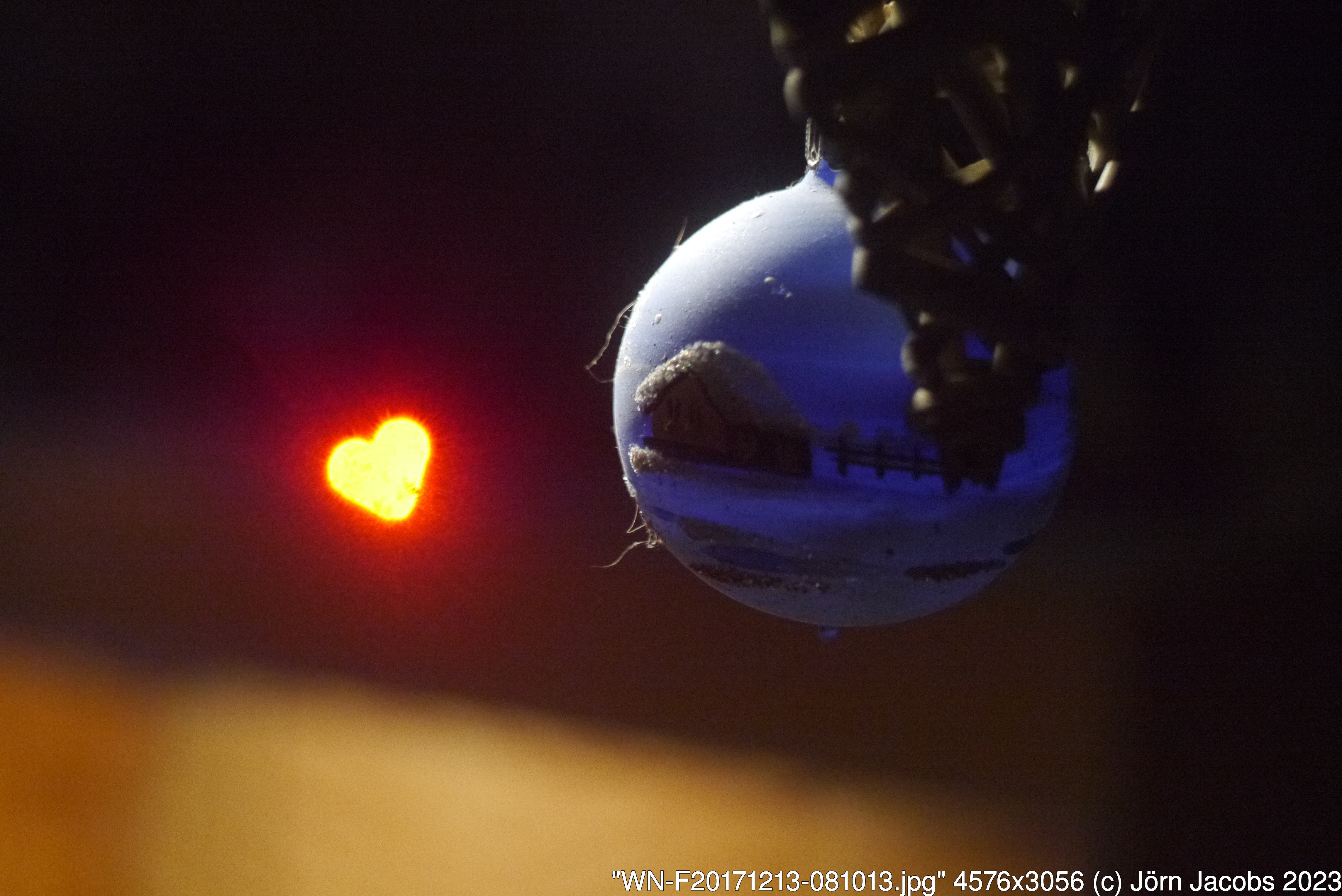 Bild 4
Bild 4
 Achtung: die Spitzlichter müssen im Unschärfebereich der
Szene liegen, sonst funktioniert es nicht!
Achtung: die Spitzlichter müssen im Unschärfebereich der
Szene liegen, sonst funktioniert es nicht!
Analoge Kameras (mechanisch, mit Film)
Es gibt eine unübersehbare Menge an Büchern über die Fotografie-Geschichte der
alten Zeit (1830 - 1995). Als "Analog" apostrophierte man Kameras in dieser
Zeit ja nicht, denn fast alle Errungenschaften der Technik funktionierten
ohnehin analog, d.h. durch sinnentsprechende Abbildung einer physikalischen
Grösse durch eine andere und wieder zurück. Speicherung war eigentlich immer mechanisch (Schallplatte) oder chemisch (Fotographie , Druck). Digital arbeiteten eigentlich nur
die Vermittlungssysteme der Telefone, und die mechanischen Rechenmaschinen.
Fotografie basierte hingegen auf hauptsächlich chemischen Prozessen, und dies
mit einem riesigen Aufwand, anfangs sogar mit einer Art Selbstherstellung auch
des "Films" (das waren selbstbeschichtete Glasplatten) für die Aufnahme. Mit
der Einführung des (trockenen) Films beschränkte sich die Arbeit dann aber nur
noch auf die "Entwicklung", der so genannten Sichtbarmachung eines
Negativbildes, und dann der Herstellung sogenannter "Abzüge" (die englisch
einfach "prints" hiessen). Die Profis und einige Hobbyisten hatten dafür eine
Dunkelkammer: Ein chemisches Labor, in der man am Ende dann das ersehnte Bild
sebst herstellen (und noch etwas nachbearbeiten) konnte. Den allermeisten
Hobbyfotografen blieb allerdings nur der Gang zum Fotoladen (oder der Weg zur
Post). Zeit war da stets einzuplanen. Und praktisch alle Fotos waren rein
schwarzweiss. Farben wurden als Grautöne wiedergegeben. Erschwinglich waren
Farbfotos dann als Dias ab Mitte der 1950er Jahre, und als Papierbilder erst ab Mitte
der 1960er Jahre. Heute hingegen schaut man sich Fotos entweder rein elektrisch
und digital auf einem (möglichst) grossen Bildschirm direkt an, oder man druckt
sie mit einem guten Farbdrucker auf Papier aus. Ironie des Schicksals: So ein
Ausdruck kostet heute ungefähr dasselbe wie früher ein (analoger) Papierabzug.
Analoge vs. digitale Kameras
Vielleicht ist dieses Thema inzwischen uninteressant, fast nur noch Geschichte.
Aber eines steht fest: Weder die alte analoge, mit lichtempfindlichem Film
arbeitende Kanera lieferte sofort brauchbare Bilder, noch tut dies die heutige
Digitalkamera. Vielmehr werden die Daten zunächst mal gespeichert. Sie müssen
dann durch einen hie chemischen, hie elektrischen Prozess an die Oberfläche
gebracht werden. Bei der Analogkamera dauert das praktisch von Minuten
(Profifotograf mit Dunkelkammer in Reichweite) bis Wochen (Hobbyfotograf,
Postweg zur "Entwicklungsanstalt" und zurück); Bei der Digitalkamera ist nun das
geknipste Bild quasi sofort auf dem Display zu begutachten. Besonders bei
schwierigen Fällen ist dies ein riesiger Vorteil, der noch getoppt wird, wenn
die Kamera nicht mehr nach dem Spiegelreflexprinzip arbeitet, sondern das
Sucherbild direkt vom Fotosensor abgeleitet wird. Dann sieht der Hobbyfotograf
sofort und unmittelbar alles unverfälscht. Besser noch, und schneller, als es
jemals mit den sogenannten Plattenkameras aus der Zeit meines Grossvaters (um 1910 bis in
die 20er Jahre) noch möglich, und mit den danach praktisch ausschliesslich
verwendeten Rollfilm- und Kleinbildkameras dann aber überhaupt nicht mehr möglich
war.
Um ein Bild schlussendlich auf Papier zu bekommen, war früher ein zweiter
chemischer Prozess ("Abzüge" erstellen) nötig. Für Digitalfotos gibt es den
(technisch gesehen auch recht komplizierten) Prozess des
Farb-Tintenstrahldruckens; viele Fotos werden allerdings heute nur noch in den
weitestverbreiteten Funk-Telefonen (oder anderen Formen des tragbaren Computers)
aufbewahrt, oder sind sogar "irgendwo im Netz" hinterlegt, haben sich noch nie
auf Papier befunden, und landen immer nur für einen (meist kurzen) Moment auf
einem Bildschirm. Eine Bildwiedergabe dort ist übrigens für viele Fälle
vorteilhaft, denn die dabei mögliche Farbigkeit (Helligkeit/Farbsättigung) ist auf
Farb-Bildschirmen immer deutlich besser, als dies beim Druck (mit Farbe auf Papier) möglich wäre.
Übrigens sind die Sucher der alten Analogkameras wesentlich besser als bei den meisten heutigen DSLRs: Das Bild ist gross (da Vollformat), hell und meist mit Einstellhilfen zur Scharfstellung versehen
(wenn kein Autofokus vorhanden war). Man wünscht sich dies für heute manchmal zurück...
Archivierung der Fotos
Viele Fotos...Viel-zu-viele Fotos...
Vor 20 Jahren hatte ich die
Vorstellung: "Wenn ich mal alt bin, kann ich die Fotos alle noch mal ansehen und schöne Erinnerungen auffrischen". Aber mit wem?
Jetzt bin ich alt, und sehe das natürlich anders: Die Fotos dienen mir heute, jetzt, in diesem Moment, und
nach mir mit grosser Wahrscheinlichkeit niemanden mehr. Sei es wie es sei: Für dieses
Fotobuch hat sich die Archivierung jedenfalls gelohnt, den ohne das Archiv
wäre es fast unmöglich, zu den Themen gezielt auch passende Beispiele zu finden
bzw. wiederzufinden.
Wie also bewahre ich meine Digitalfotos auf?
- ich
benutze das Betriebssystem Linux
- da ich Programmieren kann (meistens schreibe ich ""shell
scripts"), sind Organisiations- und vor allem Durchforstungsprogramme schnell
erstellt
- ich speichere immer abends alle Fotos des Tages von den Kameras auf einen
Laptop: Speicherkarte einstecken; den Rest macht ein Programm namens "copy-todays..."schnell und fast
selbstätig durch anklicken einer Ikone.
- egal wie die Kamera selbst die Fotos intern numeriert oder benamst: Sie werden
bei mir IMMER automatisch, gleich beim Abspeichern auf der Festplatte des Laptops, anhand der EXIF-Daten in die
Namenskonvention "Jahr-Monat-Tag-Bindestrich-Stunde-Minute-Sekunde-abcde.." umgewandelt, wobei die Dateien auf der Speicherkarte der Kamera aber original belassen werden
(solange dort noch Platz ist). Das Umbenennen im Laptop erledigt das Programm
"jhead".
- alle Kamera-Uhren sind minutengleich eingestellt (wobei ich das
Sommerzeit-Spielchen einfach ignoriere); somit kann man durchaus mit mehreren
Kameras fotografieren, und doch bleibt die "historische" Reihenfolge, also die
Reihenfolge, wie man sie noch in Erinnerung hat, auch später und bei Bildern verschiedener Kamaras erhalten.
-auf dem Laptop werden die Fotos mit dem super-schnellen, hochqualitativen
Programm "feh" grossformatig gesichtet und möglichst viele, die nicht gefallen,
sofort gelöscht (in der Kamera verbleiben sie aber).
-allfällige Bildbearbeitung, z.B. Ausschnitte, werden eventuell gleich miterledigt
-etwa alle 4-12 Wochen wird der Inhalt dieses Zeitraums auf einer Daten-CD
(heute meist Daten-DVD) gesichert und diese ins Regal gestellt.
-gleichzeitig wird derselbe Inhalt auf eine EXTERNE (!), normalerweise
ausgeschaltete(!) Festplatte gespeichert. Sie stellt das über alle Jahre laufende
Gesamtarchiv dar, in dem man nötigenfalls alles durchsuchen kann.
-eine Zeit lang habe ich mit entsprechend geschriebener Software alle Bilddateien auch mit Kurzkommentaren bzw.
Stichworten zum Inhalt versehen (Ort: Kommentarfeld im EXIF-header); dies aber habe ich inzwischen wieder aufgegeben, weil der Zeitaufwand doch recht gross ist und "Erinnerung plus Jahreszahlkennzeichnung plus
schnelles Durchsehen" doch auch ganz gangbar ist.
Autofokus
Für viele, meist eher einfache Aufnahmesituationen ist Autofokus
ganz sicher die richtige Methode für scharfe Bilder. Kleine Taschenkameras haben
oft überhaupt nur Offenblende, so dass mangels grösserer Schärfentiefe die
automatische Scharfstellung von daher ein wirklicher Segen ist. Wenn allerdings die Kamera
partout auf ein ungewünschtes Objekt scharfstellen will (mehrere Blüten an einem
Busch), oder überhaupt kein Objekt findet (Vögel oder Flugzeug vor Wolken),
muss man den Autofokus entweder austricksen (was man vorher mit der gerade verwendeten Kamera üben sollte), oder, wenn das möglich ist,
ganz ausschalten, um dann von Hand scharfzustellen.
Belichtungseinstellung(en)
Fotografie bedeutet nach Wortetymologie "Aufzeichnung mit Licht". Eine
lichtempfindliche Halbleiterschaltung (Photosensor; früher: Film) wird durch
die einfallende Energie verändert, sie "merkt" sich den Einfall. Die Szenerie,
die abgelichtet wurde, hatte nun (viele Millionen!) Farb- und
Helligkeitsinformationen in einem gewissen Bereich. Der Sensor/Film hat seinen
Arbeitsbereich aber nicht unbedingt in dem selben Bereich. Richtig belichten
heisst nun, diese Bereiche aneinander anzupassen, und insbesondere zu
vermeiden, dass sehr helle oder sehr dunkle Bereiche stiefmütterlich behandelt
werden. Praktisch alle heutigen Kameras können dies in vielen Fällen automatisch machen.
Sie versagen aber, wenn:
- zu wenig Licht vorhanden ist
- extrem zu viel Licht vorhanden ist
- ein schnellbewegtes Objekt "eingefroren" abgebildet werden soll
- schnellbewegte Objekte "verwischt" dargestellt werden sollen
- ein Schärfentiefeproblem vorliegt: Will man zusätzlich eine
bestimmte Entfernungszone scharf abgebildet haben, so MUSS abgeblendet werden,
was aber zwangsläufig das auf den Photosensor treffende Licht so stark reduziert, so dass eventuell zu wenig Licht übrig bleibt.

 Bild 16, Bild 17: Das linke Bild wurde mit ISO 100, 1/1000 s und Blende F/3.2, das rechte
mit ISO 100, 1/125 s und Blende F/8.0 aufgenommen und hat eine grössere Schärfentiefe; allerdings ist sie noch nicht gross genug, um auch den Hintergrung
scharf abzubilden. Um dies zu erreichen, müsste man noch stärker abblenden,
etwa bis Blende F/22, was sich aber bei Freihandaufnahmen wegen der Verwackelungsunschärfe (bei der dann nämlich noch länger zu wählenden Belichtungszeit) verbietet. Es sei denn, man benutzt ein Stativ, und
wartet ausserdem einen Moment der Windstille ab, wo die Blumen nicht selber wackeln (Häufiges Problem bei hohen Blumen, Gräsern und Bäumen).
Bild 16, Bild 17: Das linke Bild wurde mit ISO 100, 1/1000 s und Blende F/3.2, das rechte
mit ISO 100, 1/125 s und Blende F/8.0 aufgenommen und hat eine grössere Schärfentiefe; allerdings ist sie noch nicht gross genug, um auch den Hintergrung
scharf abzubilden. Um dies zu erreichen, müsste man noch stärker abblenden,
etwa bis Blende F/22, was sich aber bei Freihandaufnahmen wegen der Verwackelungsunschärfe (bei der dann nämlich noch länger zu wählenden Belichtungszeit) verbietet. Es sei denn, man benutzt ein Stativ, und
wartet ausserdem einen Moment der Windstille ab, wo die Blumen nicht selber wackeln (Häufiges Problem bei hohen Blumen, Gräsern und Bäumen).
Beispiel: Zwei unterschiedliche Blütengruppen in 1-m- und 3-m-Entfernung sollten gleichermassen scharf abgebildet werden. Zudem herrschte Abendlicht, die Zeit kurz nach Sonnenuntergang.
Die beiden ersten Fotos zeigten, wie es NICHT werden sollte:

Bild 18: Schärfe nur im Vordergrund bei ca. 1 m (Blende F/5.6)

Bild 19: die Schärfe begrenzt auf den Entfernungsbereich > 3 m (Blende F/5.6)
 Bild 20: Akzeptable Schärfe ab 1m bis einschl. 3 m erreicht man
nur mit völlig abgeblendetem Objektiv, was lange Belichtungszeiten
bzw. hohe ISO-Zahlen und ein Stativ erforderte.
Kamera: Canon EOS M10, Objektiv: Brw.: 50.0 mm Entf.: 1.82 m Blende:
F/ 36.0 , VsZeit 1/50 s, Empf.: 6400 ISO.
Bild 20: Akzeptable Schärfe ab 1m bis einschl. 3 m erreicht man
nur mit völlig abgeblendetem Objektiv, was lange Belichtungszeiten
bzw. hohe ISO-Zahlen und ein Stativ erforderte.
Kamera: Canon EOS M10, Objektiv: Brw.: 50.0 mm Entf.: 1.82 m Blende:
F/ 36.0 , VsZeit 1/50 s, Empf.: 6400 ISO.




Noch ein Beispiel:
Bild 22, Bild 23 und Bild 24 sind
Aufnahmen mit Kamera: Canon PowerShot A590 IS,
Objektiv: Brw.: 5.8 mm Entf.: 0.2 m
Erstes Bild:
Blende: F/ 2.6 , VsZeit 1/800 s, Empf.: 80 ISO,
dann:
F/ 5.6 , VsZeit 1/200 s, F/ 8.0 , VsZeit 1/100 s,
und schliesslich:
F/ 8.0 , VsZeit 1/100 s .
Der Fokus war auf
die weisse Blüte in Entf.: 0.2 m gesetzt; man sieht sehr deutlich
den erweiterten Tiefenschärfebereich bei F/8.0
 Ein weiterer, manchmal gangbarer Trick:
Ein weiterer, manchmal gangbarer Trick:
 Bild 26: Tiefenschärfenprobleme kann man elegant umschiffen, indem man mit einem Tele aus bewusst grösserer Entfernung (hier ca. 30m) fotografiert. So kommt die fast schon verwirrende Vielfalt dieser Blumenanflanzung gut zur Geltung. Kamera Canon PowerShot SX40 HS, 1/320s, F/5.8, ISO 100, Brennw. 105.4 mm (35 mm-Entspr. ist 588 mm), Schärfezone laut EXIF-header: 28.87 - 34.43 m. Typisch für Tele-Aufnahmen ist auch die (hier durchaus erwünschte) Unschärfe des sehr fernen, hier etwa 150m enfernten Hintergrundes.
Bild 26: Tiefenschärfenprobleme kann man elegant umschiffen, indem man mit einem Tele aus bewusst grösserer Entfernung (hier ca. 30m) fotografiert. So kommt die fast schon verwirrende Vielfalt dieser Blumenanflanzung gut zur Geltung. Kamera Canon PowerShot SX40 HS, 1/320s, F/5.8, ISO 100, Brennw. 105.4 mm (35 mm-Entspr. ist 588 mm), Schärfezone laut EXIF-header: 28.87 - 34.43 m. Typisch für Tele-Aufnahmen ist auch die (hier durchaus erwünschte) Unschärfe des sehr fernen, hier etwa 150m enfernten Hintergrundes.
Die
Belichtung generell
wird von folgenden Zusammenhängen regiert (wichtig übrigens nicht nur
für den automatisierten Rechenprozess in der Kamera, sondern gegebenenfalls eben auch im Kopf des
manuell einstellenden Fotografen). Nehmen wir als Objekt vor dem Objektiv mal
einen konstant leuchtenden Gegenstand an, und listen die sich ergebenden möglichen Fälle auf, in der Reihenfolge:
Einflussgrösse:......Veränderung:......Resultat:......
Film-/Sensorempfindlichkeit: höher eingestellt:
Folge: helle Stellen werden weiss- dunklere Stellen werden heller -
Schwarz wird grau, Bildrauschen steigt an.
Film-/Sensorempfindlichkeit: niedriger eingestellt:
Folge: ganz helle Stellen fehlen - helle Stellen werden grau -
dunklere Stellen werden schwarz -, Bildrauschen ist geringer.
Blendenöffnung (Apertur): grösser gewählt, z.B. statt 4 jetzt 2.8:
Folge: helle Stellen werden weiss-
dunklere Stellen werden heller - Schwarz wird grau,
aber Schärfentiefe wird geringer, Entfernunggseinstellung wird
kritischer, Fehler dabei wirken sich stärker aus.
Blendenöffnung (Apertur): kleiner gewählt z.B. statt 4 jetzt 5.6:
Folge: helle Stellen werden grau -
dunklere Stellen werden schwarz - ,
aber Schärfentiefe wird grösser, Entfernunggseinstellung wird
unkritischer, Fehler dabei wirken sich
nur wenig aus.
Belichtungszeit: länger eingestellt, z.B. statt 1/100 s jetzt 1/50 s: Folge: helle Stellen werden weiss-
dunklere Stellen werden heller - Schwarz wird grau , aber Verwackelungsgefahr
(Gefahr der Unschärfe des gesamten Bildes) steigt, Bewegte Objekte werden
stärker verwischt abgebildet.
Belichtungszeit: kürzer eingestellt, z.B. statt 1/100 s jetzt 1/200 s: Folge: helle Stellen werden grau-
dunklere Stellen werden fast schwarz - Verwackelungsgefahr
(Gefahr der Unscharfe des gesamten Bildes) ist geringer, Bewegte Objekte werden
eher scharf abgebildet.
Brennweite des Zoom-Objektivs:länger eingestellt ("heran-zoomen", "mehr Tele"): Folge: mehr Vergrösserung,
Verwackelungsgefahr (Gefahr der Unscharfe des gesamten Bildes) steigt. Blendenöffnung wird
(bei den meisten Zoom-Objektiven) unvermeidbar kleiner; Folge: s.o. bei "Blendenöffnung kleiner gewählt".
Brennweite des Zoom-Objektivs:kürzer eingestellt (WW):
Folge: weniger
Vergrösserung,
Verwackelungsgefahr (Gefahr der Unscharfe des gesamten Bildes) geringer. Blendenöffnung wird
(bei den meisten Zoom-Objektiven) grösser.
Allgemeine Hintergrundhelligkeit (das ist das nicht beeinflussbare Pendant
(die "Entsprechung") zu Sensorempfindlichkeit): ist gestiegen:
Folge: meist
günstig und erwünscht: besserer Kontrast überall im Bild.
Korrektur-nach-Fotografenmeinung: Aktion: Betrachten bestimmter Bildteile
und Korrekturen nach deren Erfordernissen. Folge: Andere Bildteile werden
mitverändert, und sind durch Nachbearbeitung nicht unbedingt zurückveränderbar.
Schärfentiefe
Die Schärfentiefe (also der Entfernungsbereich um den fokussierten Punkt herum, in dem die Bildelemente noch in annehmbarer Schärfe abgebildet werden),
viele sagen auch Tiefenschärfe (ich meistens auch (;-))), hängt, wie schon erwähnt, extrem von der Blendeneinstellung ab. Wir wollen uns dies noch einmal etwas genauer ansehen.
Typische Problem-Motive sind:
-Nahaufnahmen von grossen Blüten
-Aufnahmen von Zweigen oder ganzen Büschen, bei denen sehr viel oder alles scharf sein soll,
-Gegenstände im Vordergrund und im Hintergrund, die beide scharf abgebildet werden sollen
Beispiel: Ein Blumenstrauss in ca. 60cm Entfernung. Benutzte Kamera: Canon EOS50D im "live-view"-Modus, Tisch-Stativ. Objektiv: ein altes manuelles Porst 1,2/55mm, auf Canon EF-Bajonet adaptiert.
Für die Bilder wurde einmalig mit Blende F/1.2 auf das innere der grossen Blüte im Vordergrund scharfgestellt, und dann nur noch die Blende variiert. (Ausnahme: Für F/22 anderes Objektiv,( Canon Zoomobj. 35-80mm))
Bilder 27 ... 35 ()v.l.n.r.) Blende F/1.2, F/2.0, F/2.8 F/4, F/5.6, F/8 F/11, F/16, F/22









Man kann deutlich sehen, dass mit stärkerer Abblendung die Schärfe der weiter entfernt liegenden Bildteile immer besser wird, und ab etwa Blende F/8 bis zur Blende F/16 sogar das Tapetenmuster im Hintergrund sich abzeichnet.
Fazit: Man sollte für grosse Schärfentiefe möglichst stark abblenden. Dies ist aber bei unzureichend Licht nur dann möglich, wenn man ein Stativ benutzen kann (wenn nämlich die Motive unbewegt sind, und man eines dabei hat (:-|))). Ausserdem sollte man die ISO-Empfindlichkeit möglichst hoch einstellen, aber nur so hoch, dass der dadurch bewirkte Qualitätsverlust noch akzeptabel ist.
Wenn das alles nun aber nicht möglich ist, besteht noch die Möglichkeit, mit der Kamera weiter vom Objekt zurückzutreten. Dadurch wird die Schärfentiefe ebenfalls grösser! Die nun dadurch zu klein werdende Abbildung des gewünschten Objekts kann man ja mit nachträglicher Ausschnittvergrösserung kompensieren. Natürlich wird dabei die Auflösungsfeinheit in diesem Ausschnitt entsprechend geringer. Deswegen sollte man in der Kamera die höchstmögliche Auflösung wählen, falls man die nicht ohnehin immer eingestellt hat. Beispiele:
Für die folgenden Bilder wurde eine Kamera Canon EOS M10 mit einem Autofokus-Festbrennweitenobjektiv F/1.8 50mm benutzt, die Kamera auf ISO 1600 eingestellt,alle Aufnahmen wurden bei Blende F/1.8 gemacht, der Autofokus peilt den vorderen Rand der Obstétagère an:



Drei Bilder: Das erste Bild (Bild 36) zeigt die formatfüllende Nahaufnahme der Mitte der Obstétagère aus einer Entfernung von 62 cm. Die Schärfentiefe ist da natürlich völlig ungenügend.

 Das zweite Bild (37) zeigt eine Aufnahme aus einer Entfernung von 140 cm.
Das zweite Bild (37) zeigt eine Aufnahme aus einer Entfernung von 140 cm.


Das dritte Bild (38, mit gerundeten Ecken) ist dessen nachträgliche Herausvergrösserung eines dem Bild 36 entsprechenden Ausschnitts. Man sieht hier eine etwas bessere Schärfentiefe, aber es reicht noch nicht.

Das nächste Bildertripel benutzt deshalb einen Blendewert von F/4. Die Abstände sind: Erstes Bild: Nahaufnahme=73 cm und zweites Bild: Fernaufnahme=140 cm.
Bild 39

 Bild 40
Bild 40

 Bild 41 (mit gerundeten Ecken)
Bild 41 (mit gerundeten Ecken)
 Nach dem "Zurückweichen/ Rückvergrössern" auf etwa den doppelten Abstand ist die Schärfentiefe schon akzeptabel, was ein Vergleich mit dem oberen Bild zeigt.
Nach dem "Zurückweichen/ Rückvergrössern" auf etwa den doppelten Abstand ist die Schärfentiefe schon akzeptabel, was ein Vergleich mit dem oberen Bild zeigt.
 Noch besser wird es bei noch grösserem, ca. 3-fachen Abstand, hier an einem einfachen Blumenmotiv gezeigt:
Noch besser wird es bei noch grösserem, ca. 3-fachen Abstand, hier an einem einfachen Blumenmotiv gezeigt:
Bilder 42,

 43,
43,

 44:
44:

Das erste Bild (42) wurde als Nahaufnahme mit einem Abstand von 53 cm gemacht, das zweite (43) mit 141 cm Abstand. Vergleich von Nahaufnahme (42) und "Fern-Ausschnittvergrösserung" (gerundete Ecken, Bild 44) zeigt deutlich die überragende Schärfentiefe bei dieser Aufnahmetechnik.
 Anmerkung zu variiertem Bildabstand bzw. unterschiedlichen Brennweiten:
Anmerkung zu variiertem Bildabstand bzw. unterschiedlichen Brennweiten:
Besonderheiten bei Portraitaufnahmen
Bild 45:
 Das schöne Gesicht eines Menschen wollte ich aus einer Reihe von Gründen hier nicht als Beispiel nehmen. Hunde sitzen nicht ruhig genug, Katzen sind schwer zu dirigieren, Eulen zu selten, und wer weiss, wie sie bei Nahaufnahmen reagieren...
Ich habe mich deshalb hier im Haus umgeschaut und die Puppe links aus ihrer Zweisamkeit entführt, und möchte an ihr
die Bedeutung der Brennweite bzw. Entfernung zum Objekt auf die Gesichtsproportionen zeigen. Eine Puppe sitzt still und hat immer dasselbe Gesicht, wenngleich der Gesichtsausdruck doch noch ein wenig von der Beleuchtung abhängt. Camera: Canon PowerShot SX40 HS, CCD-Breite: 6.20mm, sehr weiter Zoom-Bereich. Das erste Bild (46) ist eine Nahaufnahme. Die folgenden 5 Bilder wurden aus verschiedenen Entfernungen bei jeweils möglichst gleichem Bildausschnitt mit einem Zoom-Objektiv aufgenommen, und die Bilder 2...6 dem Ausschnitt des ersten Bildes möglichst genau angepasst.
Das schöne Gesicht eines Menschen wollte ich aus einer Reihe von Gründen hier nicht als Beispiel nehmen. Hunde sitzen nicht ruhig genug, Katzen sind schwer zu dirigieren, Eulen zu selten, und wer weiss, wie sie bei Nahaufnahmen reagieren...
Ich habe mich deshalb hier im Haus umgeschaut und die Puppe links aus ihrer Zweisamkeit entführt, und möchte an ihr
die Bedeutung der Brennweite bzw. Entfernung zum Objekt auf die Gesichtsproportionen zeigen. Eine Puppe sitzt still und hat immer dasselbe Gesicht, wenngleich der Gesichtsausdruck doch noch ein wenig von der Beleuchtung abhängt. Camera: Canon PowerShot SX40 HS, CCD-Breite: 6.20mm, sehr weiter Zoom-Bereich. Das erste Bild (46) ist eine Nahaufnahme. Die folgenden 5 Bilder wurden aus verschiedenen Entfernungen bei jeweils möglichst gleichem Bildausschnitt mit einem Zoom-Objektiv aufgenommen, und die Bilder 2...6 dem Ausschnitt des ersten Bildes möglichst genau angepasst.
Man betrachte das Ergebnis: Das Bild 1 ist eine extreme Nahaufnahme, das Gesicht wird extrem pausbäckig abgebildet. Mit grösserem Abstand wird das Gesicht zunehmend flacher, der Gesichtsausdruck entspannter.
Bild 46
 Bild 47
Bild 47
 Bild 1:
ISO 250, 1/30 s, f/2.7
Entfernung: 0.14m, Brennw.: 4.3mm (35er: 25mm)
Bild 1:
ISO 250, 1/30 s, f/2.7
Entfernung: 0.14m, Brennw.: 4.3mm (35er: 25mm)
Bild 2:
ISO 800, 1/50 s f/4.5
Entfernung: 0.42m,Brennweite: 17.0mm (35er: 99mm)
Bild 48
 Bild 49
Bild 49
 Bild 3:
ISO 800 (1/50) f/4.5
Entfernung: 0.57m, Brennweite: 23.4mm (35er: 136mm)
Bild 3:
ISO 800 (1/50) f/4.5
Entfernung: 0.57m, Brennweite: 23.4mm (35er: 136mm)
Bild 4:
ISO 800, 1/40 s, f/4.5
Entfernung: 1.02m, Brennweite: 33.7mm (35er: 196mm)
Bild 50
 Bild 51
Bild 51
 Bild 5:
ISO 800, 1/30 s, f/5.8
Entfernung: 1.74m, Brennweite: 100.0mm (35er: 581mm)
Bild 5:
ISO 800, 1/30 s, f/5.8
Entfernung: 1.74m, Brennweite: 100.0mm (35er: 581mm)
Bild 6:
ISO 800, 1/40 s, f/5.8
Entfernung: 2.07m, Brennweite: 150.5mm (35er: 874mm)
Spontanfotografie
Besonders der Hobby-Fotograf wird oft spontan fotografieren wollen, in plötzlich
auftretenden Motivkonstellationen "point-and-shoot" machen wollen.
Die eigentliche Belichtung kann er dann
eigentlich nur der Belichtungs- sowie der Autofokusautomatik überlassen oder,
falls das nicht geht (siehe "Fledermäuse"):
- wahrscheinliche Einstellungen für
Entfernung, Zeit/Blende und Blitz im voraus wählen.
- vorher schon bereit
sein: Kamera in der Jacken- oder Hosentasche, falls möglich; sonst umhängen,
auch wenn das irgendwie "bieder" aussieht.
- vor dem Spaziergang Ladezustand der Batterie prüfen, und/oder Ersatzbatterie in
der Hosentasche haben.
- dasselbe gilt eventuell für die Speicherkarte
- alle Schalter der Kamera auf "Aufnahme" stellen, besonders Schiebeschalter.
- das Kameraeinschalten und die Handhabung üben! Bei den Handy-Kameras gilt dies noch besonders, da die
Benutzer-"Führung" oft unklar und sprachlich unglücklich ist, und man zudem oft nicht erkennen kann, ob und wie oft die Kamera schon ausgelöst hat.
Hingegen:
- Bilder zu "sparen" ist bei Digitalkameras kein Thema mehr: lieber mal zu früh
und/oder mehrmals auslösen als zu spät oder gar nicht. Es kann auch sinnvoll sein, die
Serienbilderfunktion einzuschalten, denn: Interessante Szenen haben manchmal die
Eigenschaft, sich spontan und unerwartet noch weiter auszuformen, und dann aber binnen
Sekunden auch wieder zu Trivialsituationen zu zerlaufen.
- Falls man ohne Blitz fotografieren möchte (bei mir eigentlich der Normalfall),
dann sollte man den ISO-Wert recht hoch wählen (oder ISO-Automatik) und bei Zoomobjektiven (und
besonders Taschenkameras!) dass Heranzoomen (Tele-Stellung) vermeiden, denn die
Weitwinkelstellung hat üblicherweise bis zu 2 Belichtungsstufen bessere Werte als die Tele-Stellung, und das kann bei wenig Licht entscheidend werden.
Blitzaufnahmen
Alle Kameras haben heute einen eingebauten Blitz, der zudem auch noch in seiner
Intensität gesteuert wird, ausgenommen der extreme Nahbereich, wo dies meist
nicht funktioniert (Überbelichtung). Und: In die "Ferne" (das ist ab ca. 2 m,
bei hoher ISO-Empfindlichkeit etwas weiter) reicht so ein Blitz nicht. Stören kann weiterhin die oft sekundenlange Wartezeit, bis der Blitz nach Auslösung wieder betriebsbereit ist.
Ich benutze den Blitz eigentlich nur in 3 Fällen:
1 wenn die Aufnahme unbedingt gelingen muss, (scharf und richtig belichtet),
und dabei alle anderen gestalterischen Merkmale zweitrangig sind.
2 bei Portraitaufnahmen im Gegenlicht:

 Wenn also die Sonne dem Haarkranz einen goldenen Schein geben soll, das Gesicht
der Person aber als wesentliches Merkmal gut erkennbar (und hübsch!) aussehen,
MUSS der Blitz benutzt werden.
Wenn also die Sonne dem Haarkranz einen goldenen Schein geben soll, das Gesicht
der Person aber als wesentliches Merkmal gut erkennbar (und hübsch!) aussehen,
MUSS der Blitz benutzt werden.
Ansonsten nur:
3 bei Fledermäusen im Flug:
Hier hat man es mit schnellen, schlecht vorhersagbaren Bewegungen und dazu noch abendlicher Dunkelheit zu tun.
Bild 53, Bild 54


Mein CHDK-Skript "fledermaus.lua" macht auf meinen Taschenkameras folgendes:
- Skriptstart sofort nach dem Einschalten
- Blitz einschalten (dadurch Ladung gesichert)
- Autofokus ausschalten
- Entfernung auf unendlich stellen
- ISO auf 1600
Dann übliches Revier in der Abenddämmerung aufsuchen, Daumen drücken und (gegebenenfalls überflink) den
Auslöser drücken!
Sehr viel leichter zu erwischen sind... Schneeflocken! Es folgen zwei fast identische Bilder aus unserem Siedlungsgeviert, bei Nacht, Kamera Lumix G3,
ISO 6400,1/2s, einmal ziemlich langweilig, und dann darunter, in derselben Minute,
gleiche Einstellunggen,
aber mit Blitz, der dank ISO 6400 sogar um etliche Meter weiter reicht als bei den
sonst üblichen ISO-Zahlen, und durch seine extrem kurze Dauer die Flocken in
mittlerem Abstand recht scharf abbildet.
Bild 55

 Bild 56
Bild 56


Anmerkung zum Blitz:
Schon früh haben die Berufsfotografen erkannt, dass man eine gewisse Verflachung des Bildeindrucks vermeiden kann, wenn der Blitz seitlich neben der Kamera sitzt und dadurch leichte Schatten entstehen. Auf einer
Hochzeit (R. und B.) habe ich mal den Fotografen gespielt:
- Canon Powershot Pro1
- Auf 6V-Triggerung umgebauter Automatik-Blitz
- mit einer Schiene seitlich neben der Kamera montiert
- Kamera auf manuelle Belichtung gestellt (feste Blende 8,
Zeit 1/60 sec oder so),
- den Blendenbereich am Blitz dementsprechend eingestellt.
- Autofokus Betrieb wie gewohnt
Schöne Fotos hat das gegeben!
Ich benutze den Blitz niemals:
1 Bei allen anderen Tieraufnahmen
2 wenn jede Störung der Szene vermieden werden muss!
3 wenn das Licht-Schatten-Spiel wesentliches Merkmal der Szene ist
4 bei schlechtem Lichtverhältnissen entscheide ich mich lieber für eine Langzeitbelichtung.
Bild 57
 Bild 58
Bild 58
 Es empfiehlt sich, bei einer neuen oder unbekannten Kamera herauszufinden, wie man den eingebauten Blitz ausschaltet. Dennoch: Aus Versehen habe ich hier geblitzt (linkes Bild); viel natürlicher wirkt das ungeblitzte Bild (rechts).
Es empfiehlt sich, bei einer neuen oder unbekannten Kamera herauszufinden, wie man den eingebauten Blitz ausschaltet. Dennoch: Aus Versehen habe ich hier geblitzt (linkes Bild); viel natürlicher wirkt das ungeblitzte Bild (rechts).
Blitzaufnahmen (Himmelserscheinung)
Bild 59
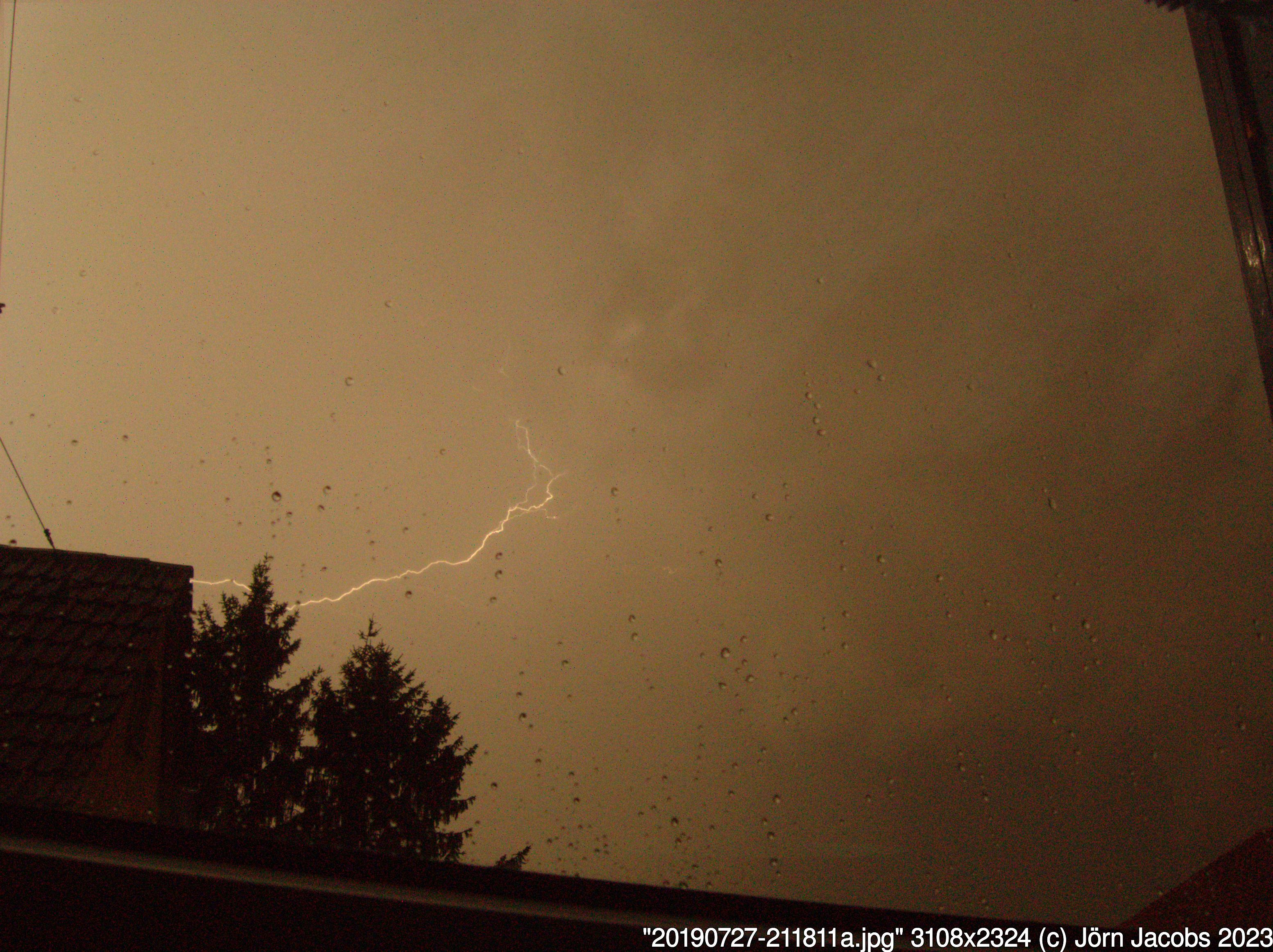 Mit der Bewegungserkennungs-Software von CHDK gelingt dies recht gut:
Man richtet die Kamera,
wenn das erste Donnergrollen ein Gewitter "im Anzug"
signalisiert,
fest (Stativ oder passende Unterlage) auf einen Bereich des (am besten: Abend-) Himmels, ein wenig
Horizont ist auch nett, und das in der Kamera laufende Skript wartet auf die auslösenden Ereignisse. Das
kann eine ganze Nacht andauern, deswegen die Kamera dann mit Netzteil oder externem Akku betreiben.
Die Kamera wird auch viele wenig brauchbare Bilder liefern, aber die kann man ja löschen.
Die (manuelle) Belichtungszeit sollte 1 s oder länger sein; dadurch wird der Abendhimmel
heller und die Wahrscheinlichkeit, einen oder mehrere Folgeblitze zu erwischen, steigt auch.
Das erste Foto meiner Versuche war etwas mager, aber gelang schon mal im Prinzip:
Mit der Bewegungserkennungs-Software von CHDK gelingt dies recht gut:
Man richtet die Kamera,
wenn das erste Donnergrollen ein Gewitter "im Anzug"
signalisiert,
fest (Stativ oder passende Unterlage) auf einen Bereich des (am besten: Abend-) Himmels, ein wenig
Horizont ist auch nett, und das in der Kamera laufende Skript wartet auf die auslösenden Ereignisse. Das
kann eine ganze Nacht andauern, deswegen die Kamera dann mit Netzteil oder externem Akku betreiben.
Die Kamera wird auch viele wenig brauchbare Bilder liefern, aber die kann man ja löschen.
Die (manuelle) Belichtungszeit sollte 1 s oder länger sein; dadurch wird der Abendhimmel
heller und die Wahrscheinlichkeit, einen oder mehrere Folgeblitze zu erwischen, steigt auch.
Das erste Foto meiner Versuche war etwas mager, aber gelang schon mal im Prinzip:
Und dann kam der grosse Fang auf den Photosensor:
Bild 60

CHDK
Vor etwa 15 Jahren startete eine Gruppe von kamerabegeisterten Programmierern
im Internet ein Projekt "Canon Hack Development Kit", das die fotografischen
Möglichkeiten der kleineren Canon-Kameras um interessante, für Bastler und
Tüftler reizvolle Möglichkeiten erweitert, u.a. Bewegungserkennung,
skriptgesteuerte Aufnahmen, Langzeitaufnahmen u.v.m. Dabei bleibt die
Original-Software der Kamera unverändert.
Bild 61
 Durch einfachen Tastendruck kann man jederzeit wieder auf die Original-Software
zurückschalten. Das ganze ist kostenlos herunterladbar, residiert auf der
SD-Karte, und wird von freiwillig tätigen Idealisten gepflegt und
weiterentwickelt. Die Welt ist da mal ziemlich in Ordnung, finde ich. Wer wie
ich zudem noch ein faible für das Selberprogrammieren (Programmsprache hier "lua")
hat, ist dann noch zusätzlich ganz in seinem Element. Und zum Ausprobieren eigener Programme ("scripts") sind Digitalkameras sehr geeignet, da "filmlos", misslungene - und Probeaufnahmen sind ja einfach zu löschen. Es gibt auch bereits
viele sehr gute fertige Programme ("SCRIPTS" genannt), wie z.B. das Skript
"CHDKPlus2.8", das die meisten Kameras mit quasi beliebigen
Belichtungsenstellungen arbeiten lässt, auch solche Kameras, bei denen dies
ursprünglich nicht vorgesehen war.
Durch einfachen Tastendruck kann man jederzeit wieder auf die Original-Software
zurückschalten. Das ganze ist kostenlos herunterladbar, residiert auf der
SD-Karte, und wird von freiwillig tätigen Idealisten gepflegt und
weiterentwickelt. Die Welt ist da mal ziemlich in Ordnung, finde ich. Wer wie
ich zudem noch ein faible für das Selberprogrammieren (Programmsprache hier "lua")
hat, ist dann noch zusätzlich ganz in seinem Element. Und zum Ausprobieren eigener Programme ("scripts") sind Digitalkameras sehr geeignet, da "filmlos", misslungene - und Probeaufnahmen sind ja einfach zu löschen. Es gibt auch bereits
viele sehr gute fertige Programme ("SCRIPTS" genannt), wie z.B. das Skript
"CHDKPlus2.8", das die meisten Kameras mit quasi beliebigen
Belichtungsenstellungen arbeiten lässt, auch solche Kameras, bei denen dies
ursprünglich nicht vorgesehen war.
Nähere infos zu CHDK z.b. bei www.forum.chdk-treff.de
Im Bild 62 (links)
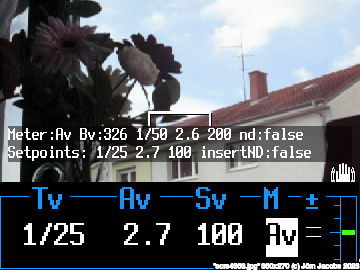
 ist die in das Display eingeblendete Benutzerführung des Skripts
"CHDKplus" zu sehen, Bild 63 (rechts) ist das mit diesen Einstellungen
geknipste Bild.
ist die in das Display eingeblendete Benutzerführung des Skripts
"CHDKplus" zu sehen, Bild 63 (rechts) ist das mit diesen Einstellungen
geknipste Bild.
Nebenbemerkung noch zur Sucher-Auflösung: Bei fast allen Klein-Kameras gibt's (im wesentlichen aus Geschwindigkeitsgründen) die freudige Überraschung, dass das tatsächlich fotografierte (und abgespeicherte) Bild immer
eine wesentlich bessere Qualität (Detailschärfe, Farbumfang, Gradation) hat als
das Sucher- bzw. Displaybild.
Crop factor
Bei Kameras für Wechselobjektive ist dies der Faktor, um den
der Fotosensor kleiner ist als das "normale" 24x36mm-Format (auch "35 mm" genannt, da der Film "damals" 35mm breit war, nämlich 24mm-Bildhöhe + beidseitig Rand/Perforation = 35mm).
Die meisten erschwinglichen (oder auch: auf Kompaktheit getrimmten) Digitalkameras haben realerweise einen sogenannten crop-Faktor ("Abschälungs-" Faktor) von z.B. 1.6,
was bedeutet, dass der Bildsensor um den Faktor 1/1.6 kleiner ist als 24x36mm. Ein Teil des vom Objektiv "entworfenen" Bildes landet dann ausserhalb der Sensorfläche.
Dadurch wirkt ein altes Normalobjektiv von 50mm Brennweite dann real wie ein
leichtes Teleobjektiv, verhält sich also entsprechend einem Tele von 80mm.
Ein 35mm-Ojektiv, also ein ehemaliges leichtes Weitwinkel, verhält sich dann
wie ein Normalobjektiv, usw, usw.
Verbreitet ist auch der crop-Faktor 2; den haben die sogenannten MFT
("micro-4/3")-Kameras, wo die Normalbrennweite dann eben nur 25mm beträgt. Das wäre dann
für so eine Kamera das "Normalobjektiv"; das sagt man aber so nicht.
N B. Die Anzahl der Megapixel (und damit die Auflösungsfeinheit) ist in
der Praxis der angebotenen Kameras nicht vom crop-Faktor abhängig
(Die einzelnen Pixel sind dann halt entsprechend kleiner). Allerdings ist
die Gesamt-Qualität, vor allem das Rauschverhalten, dann doch vom der Grösse der Pixel
(und damit der Bildsensor-Grösse) abhängig.
Digitale Kameras
...kann man mit Fug und Recht als absolutes Wunderwerk der Technik bezeichnen. Edle Feinmechanik, ein hochkomplexer Fotosensor und ein ausgewachsener Mikro-Prozessor mit Software für die gesamte Bildverabeitung und Ablaufsteuereung, was jedem PC an Genialität der Software und Leistungsfähigkeit das Wasser
reichen könnte.
Seit etwa 2004 benutze ich nur noch Digitalkameras.
Englische Wörter
crop factor = Faktor, um den der Fotosensor der Kamera kleiner ist als
der als "Vollformat" betrachtete 24 X 36 mm-Sensor einer 35mm-Kamera.
landscape = bei Formatangaben: "Querformat"
lens = Objektiv; die Engländer können nicht "objective" sagen, denn dieses Wort bedeutet "Ziel" (eines Vorhabens usw.)
close-up lens = Nahlinse,
fisheye lens = extremes, meist stark verzeichnendes Weitwinkelobjektiv
telephoto lens = Teleobjektiv
DSLR = Digital Single Lens Reflex, also: Digitale einäugige Spiegelreflex-Kamera
SLR = Single Lens Reflex, also: Einäugige Spiegelreflex-Kamera
flange focal distance = Auflagemass, Abstand vom
(Bajonett-usw-)Anschluss zum Fotosensor (d.h. bis zur Bildebene)
portrait = bei Formatangaben: "Hochformat"
print = Abdruck, Ausdruck, (veraltet:) Abzug.
kit = Satz ("zusammengehörige Sachen") ; oft: Ein Gerät mit seinen Zubehörteilen
Fremdobjektive: Objektivanschlüsse und Adapter
Objektivanschlüsse
Bei den Kameras, die für Wechselobjektive vorgesehen sind, gibt es eine Reihe
verschiedener, meist proprietärer Anschlüsse. Näheres siehe Wikipedia! Die
am meisten verbreiteten und ihre Eigenschaften sind:
T2
ein rein mechanischer
Anschluss von (??Tokina), auf den dann erst noch Adapter für M42, PK,Canon EF usw.
aufgeschraubt werden müssen. Achtung: Gewinde bei T2 ist metrisch M42x0,75mm, beim
M42-Adapter hingegen metrisch M42x1mm. Die Gewinde passen also nicht
aufeinander, höchstens und ohne Gewalt (!) nur die erste Umdrehung.
M42 Auflagemass:45,46mm crop-Faktor an EOS20D, EOS50D, EOS300D usw. : 1,6.
EF ("CanonEOS") Auflagemass: 44mm, crop-Faktor an EOS20D, EOS50D, EOS300D usw. : 1,6.
Pentax K("PK") Auflagemass 45,46mm, crop-Faktor an EOS20D, EOS50D, EOS300D usw. : 1,6.
MFT ("micro-four-thirds") wird sowohl von Olympus als auch von Panasonic ("Lumix") benutzt.
Das Auflagemass (flange focal distance) beträgt nur 19,25mm. Sensorgrösse 18x13,5mm.
crop-Faktor 2,0.
Adapter
Bild 64
 Es gibt, wie auch schon weiter
oben erwähnt, Adapter für einige Anschlüsse, aber
schon aus mechanischen Gründen (Durchmesser, Auflagemass) nicht unbedingt für alle. Ich benutze z.B:
Es gibt, wie auch schon weiter
oben erwähnt, Adapter für einige Anschlüsse, aber
schon aus mechanischen Gründen (Durchmesser, Auflagemass) nicht unbedingt für alle. Ich benutze z.B:
M42-auf-CanonEOS für die vielen alten Normal- und Teleobjektive,
die ich besitze. Die Entfernung und die Blende muss nun natürlich von Hand
eingestellt werden, und: ganz wichtig: Die Kamera muss in den Av-Modus
("Belichtungsautomatik") gestellt werden!
CanonEOS(EF)-auf-EF-M Ein Adapter, der sowohl die
mechanischen als auch die elektrischen Parameter
umwandelt. Ich benutze einen Meike MK-C AF4 Adapter an meiner Canon M10 und kann dadurch nun im Prinzip fast alle
CanonEOS-Objektive benutzen. Siehe aber: crop-Faktor.
Pentax-K(PK)-auf-CanonEOS: Benutzt für einige PK-Objektive, die ich noch von früher habe.
M42-auf-MFT und CanonEOS-auf-MFT: Benutze ich für die manuellen Objektive
(altes Tessar, oder spezielles Superweitwinkel von Samsung (fisheye) usw.)
an der MFT-Kamera Lumix G3.
Für bestimmte Fälle, so z.B. für
CanonEOS(EF)-auf -EFM
oder
CanonEOS(EF)-auf-MFT(micro4/3),
bei denen ja für die
zu adaptierenden Objektive ein deutlicher "crop factor" auftritt,
gibt es mit den sogenannten "speed boosters" mit Faktor 0.7 noch
Adapter, die - ausser der Durchleitung der elektrischen Signale -
noch zweierlei Veränderungen bewirken:
1. Bei einem crop faktor von 1.6, also z.B. bei der EOS M10, wird dieser durch den Adapter praktisch aufgehoben: Ein "Normalobjektiv" 50mm ist also tatsächlich
"normal", und nicht mehr ein leichtes Tele von 80mm.
2. "Boosting the speed". Diese Adapter vergrössern die
Apertur um eine Blendenstufe. Das ist immer dann ausserordentlich
günstig, wenn schlechte Lichtverhältnisse "Offenblende"
erfordern (und dabei der geringere Tiefenschärfenbereich
zu verschmerzen ist.). Beispiel: (Tier-)Portraits bei wenig Licht.
Ferner gibt es auch noch in der anderen Richtung arbeitende Adapter, z.B. solche, die die Brennweite umd den Faktor 1.5 verlängern, und auch die elektrischen Signale durchleiten, so dass man nicht auf Autofokus und Blendensteuerung verzichten muss.
Mein
Grossvater
 (mütterlicherseits) E.P. (ca. 1880 -1952) war schon während seiner
Zeit als Offizier der kaiserlichen Marine und als
Schiffsingenieur ein begnadeter Hobby-Fotograf
und nach dem 1. Weltkrieg dann u.a. auch als Fotograf tätig. Einige Fotos sind
überliefert, die zugleich Zeitdokumente und Kunstwerke sind, z.B. das Kinderbild von meiner Mutter und ihrer Schwester, oder das Bild einer Roma-Familie,
oder einfach die Dorfstrasse von Gr. Ippener im Schnee.
(mütterlicherseits) E.P. (ca. 1880 -1952) war schon während seiner
Zeit als Offizier der kaiserlichen Marine und als
Schiffsingenieur ein begnadeter Hobby-Fotograf
und nach dem 1. Weltkrieg dann u.a. auch als Fotograf tätig. Einige Fotos sind
überliefert, die zugleich Zeitdokumente und Kunstwerke sind, z.B. das Kinderbild von meiner Mutter und ihrer Schwester, oder das Bild einer Roma-Familie,
oder einfach die Dorfstrasse von Gr. Ippener im Schnee.



Gute Bilder im technisch-handwerklichen Sinne:
Gut sind:
maximal mögliche Schärfe, durch Verwackelungsfreiheit,
Hauptmotiv liegt im Schärfentiefebereich, Rauscharm durch nicht zu hohe ISO-Werte,
möglichst gut aufgelöst, durch hohe Megapixel-Zahl und überstrahlungsfreie
Belichtung, wobei auch das Objektiv mitmischt.
Kontrastreich wo inhaltlich gewünscht, durch entsprechende Belichtung
Die folgende Tele-Aufnahme einer Hauswand war aus irgendwelchen Gründen zu flau geraten, und ist deshalb ins Bildbearbeitungsprogramm geladen worden (linke Hälfte oberes Bild). Die Helligkeitsverteilung rechts zeigt den Mangel sehr deutlich: Es gibt praktisch kein Schwarz in diesem Bild. Mit einer Veränderung der Gradationskurve (unteres Bild) kann man hier sehr viel verbessern.
Nicht so gut ginge dies indes bei Portraits und ähnlich delikaten Aufnahmen. Hier würde jede Veränderung sehr unnatürlich oder sogar grotesk wirken.
Bild 65
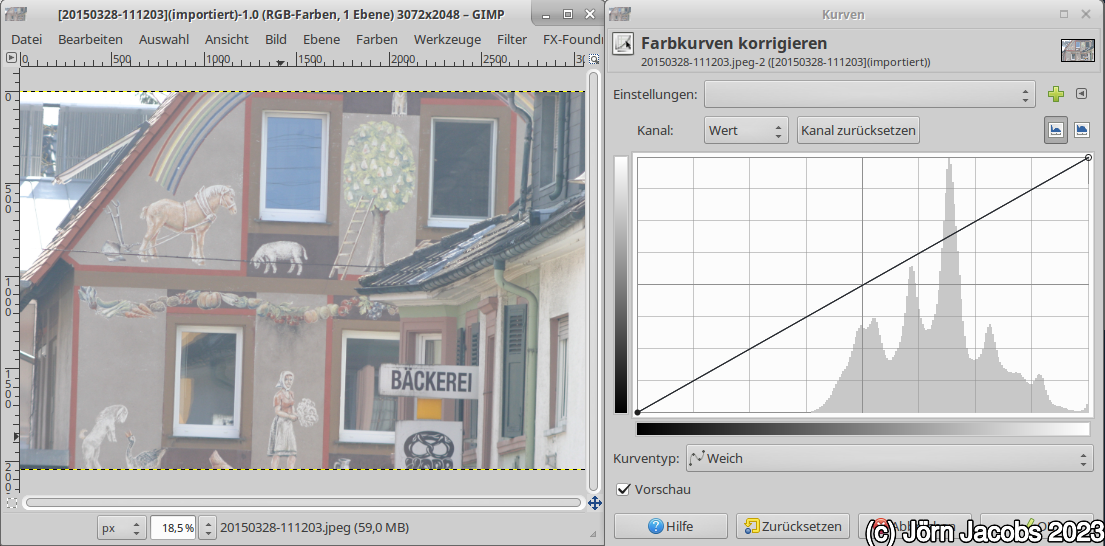 Bild 66
Bild 66
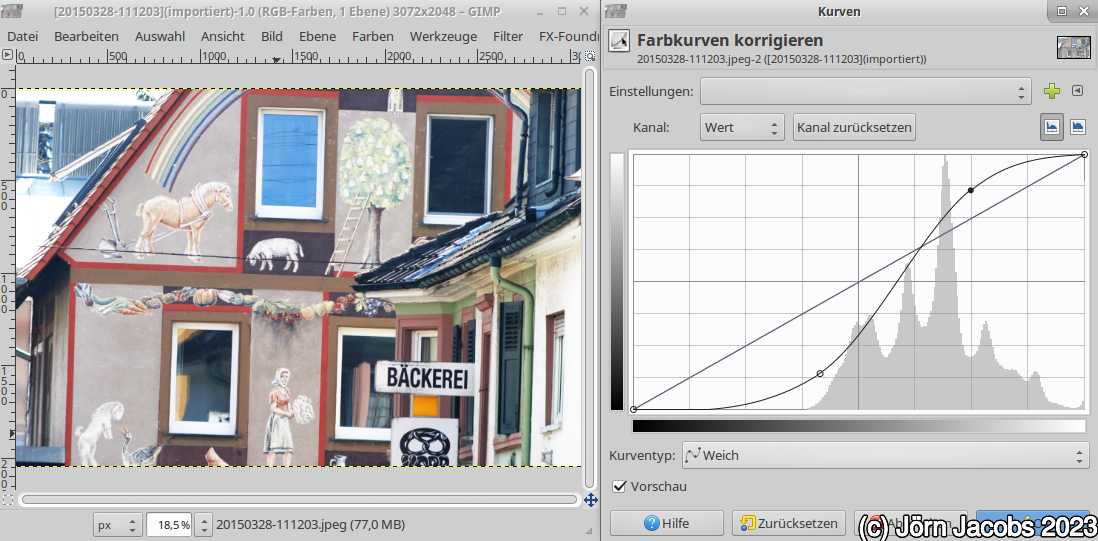
 Es gibt Situationen, in denen man ein schlechtes Foto in Kauf nimmt, um überhaupt einen Eindruck mit nach Hause nehmen zu können. So ein Fall ist das folgende Bild 67, das vom Donnersberg (Rheinland-Pfalz) aus vormittags in Richtung Osten aufgenommen wurde. Die Sicht war enttäuschend schlecht, alles war von einem Dunstschleier überzogen. Umso erstaunlicher war allerdings, nachträglich zuhause mit Bildverarbeitung vorgenommen, die Wirkung einer Kontrastanhebung, die daraus ein zwar hässliches, aber doch wesentlich informativeres Bild (Bild 68, rechts) gemacht hat.
Es gibt Situationen, in denen man ein schlechtes Foto in Kauf nimmt, um überhaupt einen Eindruck mit nach Hause nehmen zu können. So ein Fall ist das folgende Bild 67, das vom Donnersberg (Rheinland-Pfalz) aus vormittags in Richtung Osten aufgenommen wurde. Die Sicht war enttäuschend schlecht, alles war von einem Dunstschleier überzogen. Umso erstaunlicher war allerdings, nachträglich zuhause mit Bildverarbeitung vorgenommen, die Wirkung einer Kontrastanhebung, die daraus ein zwar hässliches, aber doch wesentlich informativeres Bild (Bild 68, rechts) gemacht hat.



 gut belichtet, so dass es dem Motiv entsprechend
entweder besonders realistisch aussieht (affirmative Abbildung)
gut belichtet, so dass es dem Motiv entsprechend
entweder besonders realistisch aussieht (affirmative Abbildung)
(# Beispiel enfügen)
oder durch Verschiebung der Gradationskurve
gemeinhin unbeachtete Details hervorhebt (partielle Kontrastierung).
(# Beispiel einfügen)
Nicht gut wirken meistens Abweichungen von der Natürlichkeit, wenn diese unbeabsichtigt, eventuell sogar nur
technisch bedingt sind (z.B. Blitz sitzt zu nahe am Objektiv, was praktisch bei
allen Kompaktkameras fast unvermeidlich so ist, wodurch ALLE Schatten im Bereich des Blitzes verschwinden.)
(# Beispiel enfügen)
Handy-Kameras
Die heutigen Funktelefone
("Handys", engl. nur: "cellphones") haben alle eine oder zwei Miniaturkameras eingebaut.
Die Auflösungsfeinheit entspricht dabei zwar der einer einfacheren
Taschenkamera; Bildsensor und Brennweite sind aber extrem klein. Reale Portraits mit Telefon-Kameras /"smartphones" zeigen
zudem oft rundliche (pausbäckige) Gesichter, was auf eine Weitwinkelstellung des Objektivs als oft benutzter "Normalfall"
hindeutet. Die Belichtungssteuerung hingegen ist meist exzellent, und zusammen mit der
(wohl meistens mit Softwaremitteln realisierten) Bildstabilisierung und
natürlich dem Autofokus führt dies dann oft doch noch zu akzeptablen Fotos. Der Hauptvorteil ist
letztlich dass von der Gesellschaft inzwischen akzeptierte, eigentlich sogar schon geforderte "immer dabei". Allerdings ist die Bedienung der Kamera-Funktion oft sehr
umständlich. Nur wenige (ältere) Modelle erlaubten es, die Kamera direkt und sofort
einzuschalten und auszulösen, was für viele Zwecke ja ausschlaggebend
wäre. Für Spontanaufnahmen kommt man manchmal nicht schnell genug zum Auslösen. Üben ist also angesagt, wie auch eventuelles Weiterbearbeiten.
Oft gilt:
Bild 69:
 Der Moment macht das Bild. Kamera Canon SX40, die gerade greifbar herumlag und wie praktisch alle heutigen "richtigen" Kameras innert einer halben Sekunde knipsbereit ist.
Der Moment macht das Bild. Kamera Canon SX40, die gerade greifbar herumlag und wie praktisch alle heutigen "richtigen" Kameras innert einer halben Sekunde knipsbereit ist.
Fotografierenswerte Situationen währen halt nicht ewig.

Meine alten Kameras (gone or disused)
Die schon in der Einleitung erwähnte Box:
Bilora Blitz Box
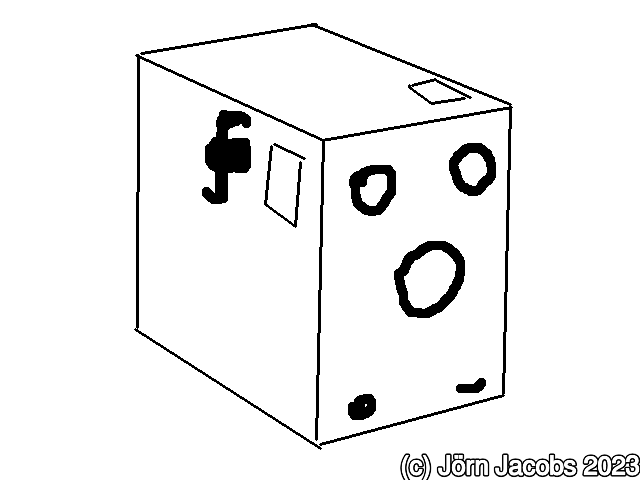
Das war also meine erste Kamera. Sie war ein treuer Begleiter. Zu meinem Erstaunen hatten auch einige Erwachsene in meinem Umfeld so eine Box.
Jeder kannte sich aus, wie man den Rollfilm einlegt und weiterdreht bis die Zahlen (1 bis 8) im roten Sichtfenster erschienen, wie man sie halten musste, damit die Bilder "gerade" wurden (d.h. der Horizont waagerecht abgebildet wird).
 Der "treue" Eindruck der Box wurde noch unterstrichen durch die zwei "Augen",
das waren die beiden
kleinen Spiegelsucher, die oben eingebaut waren, und jeweils dann von oben
beschaut die Szene klein, aber sehr plastisch im Hoch- oder Querformat abbildeten.
Der "treue" Eindruck der Box wurde noch unterstrichen durch die zwei "Augen",
das waren die beiden
kleinen Spiegelsucher, die oben eingebaut waren, und jeweils dann von oben
beschaut die Szene klein, aber sehr plastisch im Hoch- oder Querformat abbildeten.
Mit dieser ist ganz
sicher das nebenstehende Bild entstanden, und hat die Zeiten als "Kontaktabzug"
überdauert. Diese Repro-Methode war, weil viel billiger, sehr verbreitet und
lieferte Bilder in exakt derselben Grösse wie das Negativ. Das Bild zeigt im
Hochformat 6x9cm zwei Schwäne im Park Manhagen, 1956 aufgenommen.
Agfa Isolette I (1:4,5 / 85 )
Sie benutzte ebenfalls den Rollfilm. Der lieferte hier nicht 8, sondern 12 quadratische Aufnahmen 6x6cm.
 Mit ihr habe ich als teenager alle möglichen Fotos gemacht. Natürlich nur
in Schwarzweiss, denn Farbfilme und -abzüge waren viel zu teuer!
Für Innenaufnahmen gab es ein Blitzgerät, in dem Einmal-Blitzbirnen elektrisch
gezündet wurden. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen übrigens, denn eine
(grosse) Blitzbirne kostete 40 Pfennig, etwa so viel wie eine
Kinderfahrkarte für die U-Bahn-Fahrt nach Hamburg, machte ein
deutliches Explosionsgeräusch und hinterliess den Geruch von verbranntem Plastik.
Mit ihr habe ich als teenager alle möglichen Fotos gemacht. Natürlich nur
in Schwarzweiss, denn Farbfilme und -abzüge waren viel zu teuer!
Für Innenaufnahmen gab es ein Blitzgerät, in dem Einmal-Blitzbirnen elektrisch
gezündet wurden. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen übrigens, denn eine
(grosse) Blitzbirne kostete 40 Pfennig, etwa so viel wie eine
Kinderfahrkarte für die U-Bahn-Fahrt nach Hamburg, machte ein
deutliches Explosionsgeräusch und hinterliess den Geruch von verbranntem Plastik.
 Bildbeispiele: Die Dokumentation
Bildbeispiele: Die Dokumentation  "Vaters Auto im Schlamm" Bild 72,
"Vaters Auto im Schlamm" Bild 72,
 dann meine Star-Aufnahme "1963, Hamburg: Mönkebergstrasse bei Nacht",
Bild 73,
dann meine Star-Aufnahme "1963, Hamburg: Mönkebergstrasse bei Nacht",
Bild 73,
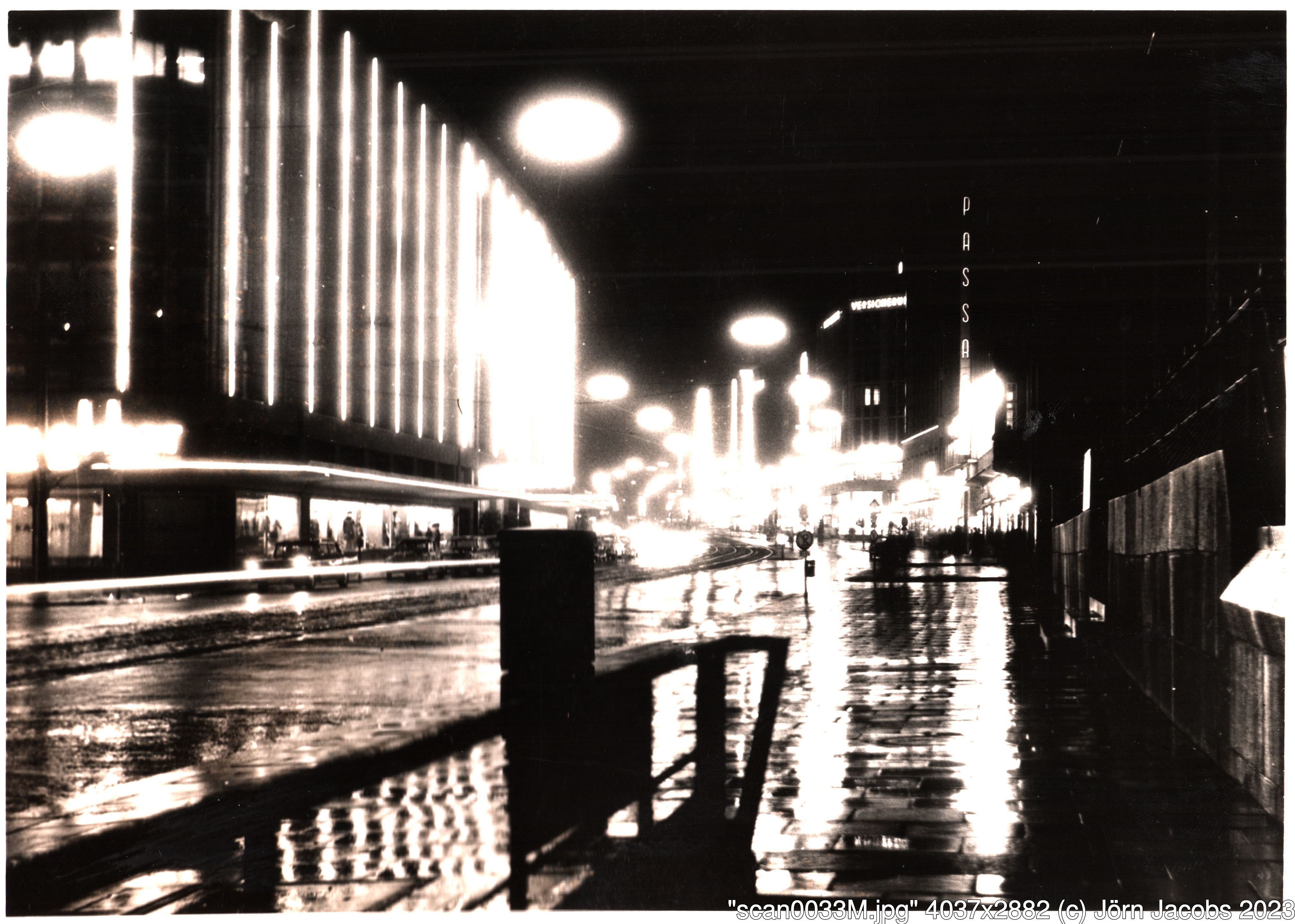

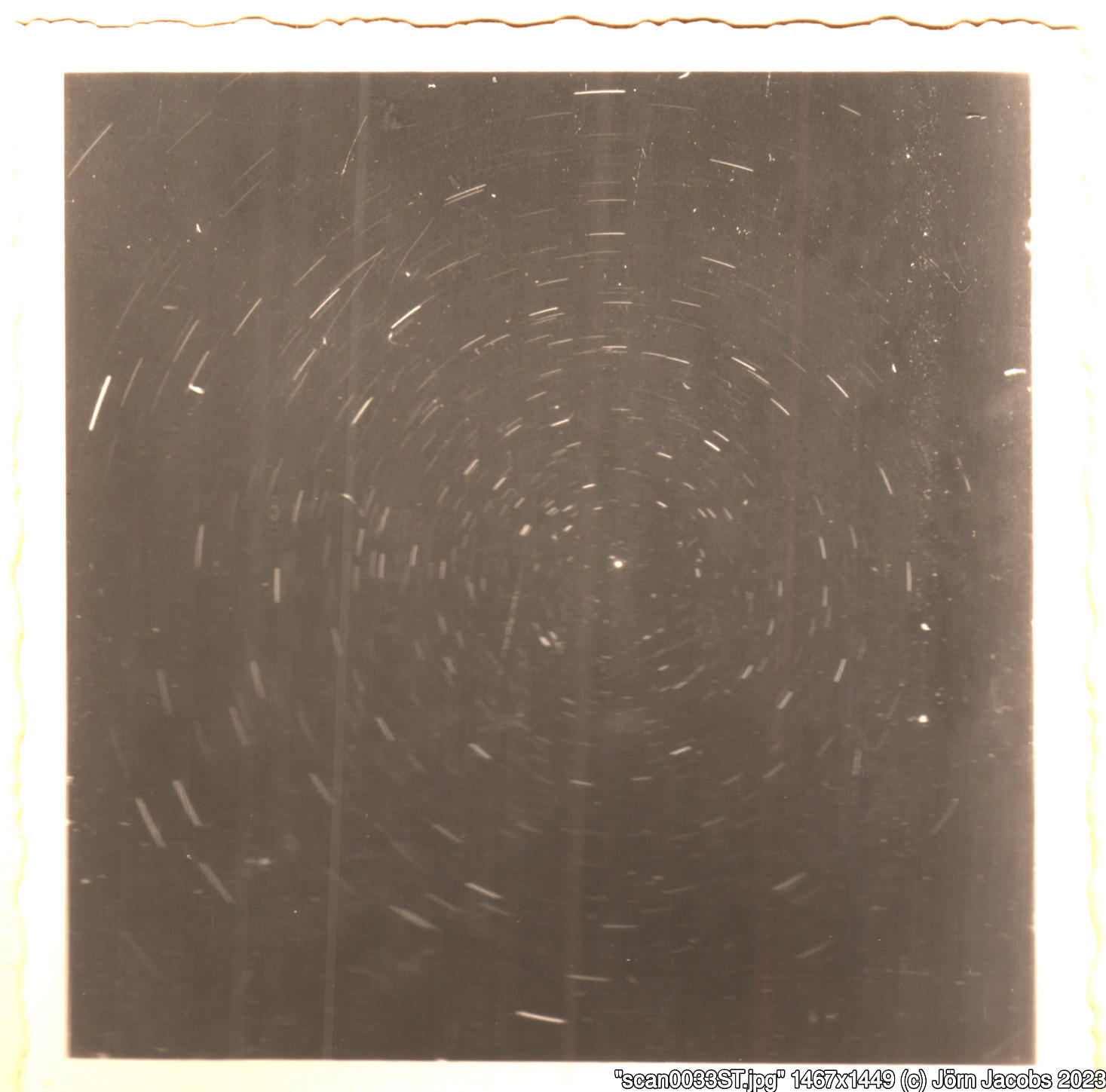 und schliesslich, und damit habe ich bei meinem Physiklehrer geprahlt,
das Bild 74 "Sterne rund um den Polarstern",
mit Blende f/4.5 und 1/2 Stunde Belichtungszeit.
Dazu brauchte man ein Stativ, und einen "Drahtauslöser mit Feststellschraube".
und schliesslich, und damit habe ich bei meinem Physiklehrer geprahlt,
das Bild 74 "Sterne rund um den Polarstern",
mit Blende f/4.5 und 1/2 Stunde Belichtungszeit.
Dazu brauchte man ein Stativ, und einen "Drahtauslöser mit Feststellschraube". 
Zu erwähnen ist auch das folgende von mir fotografierte Bild, typisch für die
damalige Not, Landschaftsaufnahmen auf quadratischem Bildformat unterbringen zu
müssen. 6x6cm ist eben kein "landscape" (engl. für Querformat).
 Das ergab dann diese neckischen Rhombusfotos. Bild 75: Heidelberg, 1959. Übrigens das
Geburtsjahr meiner Frau, einer Heidelbergerin. Als Kind wusste ich NICHT, dass
ich Jahrzehnte später hier wohnen würde...
Das ergab dann diese neckischen Rhombusfotos. Bild 75: Heidelberg, 1959. Übrigens das
Geburtsjahr meiner Frau, einer Heidelbergerin. Als Kind wusste ich NICHT, dass
ich Jahrzehnte später hier wohnen würde...
Zum Farbton des Bildes: Das war damals modischer
Standard, hiess "chamois" und sollte, besonders bei Hauttönen, "natürlicher"
aussehen. Man konnte für das Fotopapier zwischen "chamois" und
"weiss" wählen, sowie zwischen "Hochglanz" (klebte gern, wenn feucht geworden) und
"matt". Und zwischen "glattem Rand" und "Büttenrand" (für letzeren gab es eine besondere
Profilschere).
Welta Weltix
Vorkriegs-Kleinbild-Kamera vom Vater. Zusammenklappbar und sehr handlich. Aufnahmen vom Kleinbildfilm mussten vergrössert werden, und das waren ja mindestens 20, oder
normalerweise sogar 36 Bilder. Für ein paar Wochenendbilder viel zu viele und
viel Geld auf einen Schlag zu bezahlen. Auch waren ja immer diverse Fotos "nix
geworden". Sparsame und vorsichtige Hobbyfotografen orderten deshalb erst mal
einen "Streifenabzug" dieser Miniatur-Bildchen des (Negativ-)Films, - als Kontaktabzug war der recht billig - , um ein positives Abbild des gesamten Filmstreifens zu haben und um
dann zu entscheiden, welche Bilder man wirklich haben wollte. Denn, das lernte man damals schnell: Es ist völlig unmöglich, aus dem Negativbild eines Portraits zu entscheiden, od die
Person freundlich lächelt oder hämisch grinst!
Wahrscheinlich mit dieser Welta Weltix aufgenommen wurde dieses Familienfoto, denn die
Kamera hatte einen Selbstauslöser, und, was horizontal, wie man an dem Bild
sieht, allerdings nichts nützte, einen sogenannten Parallaxen-Ausgleichssucher.
 Der Sucher war oben auf dem Kameragehäuse montiert und in 2 Stellungen ("nah"
und "fern") arretierbar. Die Kamera ist wohl nach dem Auslösen noch "verrückt"
(ge)worden, deshalb die exzentrische Bildgestaltung!
Der Sucher war oben auf dem Kameragehäuse montiert und in 2 Stellungen ("nah"
und "fern") arretierbar. Die Kamera ist wohl nach dem Auslösen noch "verrückt"
(ge)worden, deshalb die exzentrische Bildgestaltung!
Franka Solida III (mit Objektiv 1:2,8 / 75 )
Rollfilm-Kamera mit 12 Aufnahmen, Aussehen ähnlich wie die Isolette oben. Das
lichtstarke Objektiv klang zwar vielversprechend, aber da kein Entfernungsmesser
eingebaut war (und die Schärfentiefe zudem ungewohnt gering), sind damit eigentlich nie
akzeptable Aufnahmen gelungen.
Kodak Retina IIc
 Eine edle Kleinbild-Kompaktkamera; sie
passte zusammengeklappt sehr gut in eine Jackentasche.Um 1970 gebraucht gekauft für DM
300.- bei Foto-Brell in Frankfurt. Sie hat mich auf unzähligen Reisen
der 70er Jahre begleitet. Sie hat einen gekuppelten Entfernungsmesser, die
Entfernungseinstellung ist schnell und direkt (das ganze Linsenpaket wird
verschoben) und im geschlosssenen Zustand steht die Kamera mechanisch bedingt
immer auf Unendlich. Das war absolut genial, da sehr viele Aufnahmen von
Unendlich ausgehend schnell fokussiert werden können. Leider hatte sie keinen Belichtungsmesser eingebaut (das
hatte wohl erst das Modell IIIc (?); ich kaufte mir deshalb einen kleinen
Gossen Sixtino für ca. DM 70.-. Unzählige superscharfe Dias (auf Kodachrome
II, später Kodachrome 25 genannt), der nur 40 ASA (heute: 40 ISO)
Empfindlichkeit hatte, sind damit entstanden (... und durch die Zeitläufte grösstenteils verschwunden... (;-|) ).
Eine edle Kleinbild-Kompaktkamera; sie
passte zusammengeklappt sehr gut in eine Jackentasche.Um 1970 gebraucht gekauft für DM
300.- bei Foto-Brell in Frankfurt. Sie hat mich auf unzähligen Reisen
der 70er Jahre begleitet. Sie hat einen gekuppelten Entfernungsmesser, die
Entfernungseinstellung ist schnell und direkt (das ganze Linsenpaket wird
verschoben) und im geschlosssenen Zustand steht die Kamera mechanisch bedingt
immer auf Unendlich. Das war absolut genial, da sehr viele Aufnahmen von
Unendlich ausgehend schnell fokussiert werden können. Leider hatte sie keinen Belichtungsmesser eingebaut (das
hatte wohl erst das Modell IIIc (?); ich kaufte mir deshalb einen kleinen
Gossen Sixtino für ca. DM 70.-. Unzählige superscharfe Dias (auf Kodachrome
II, später Kodachrome 25 genannt), der nur 40 ASA (heute: 40 ISO)
Empfindlichkeit hatte, sind damit entstanden (... und durch die Zeitläufte grösstenteils verschwunden... (;-|) ).
Zu der Retina besitze ich noch ein Vorsatztele, bei dem die (abnehmbare)
Frontlinse durch ein Glassungeheuer ersetzt wird, dass dann die Brennweite von
50 auf 80mm erhöht. Zusammenklappen dann nicht mehr möglich. Hatte ich auf
Reisen oft auch dabei. P.S. Das Objektiv ist ein edles Schneider-Kreuznach
Retina-Xenon.
 Bild 77: Rolleiflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6cm aus den
1940er Jahren (wegen: "by appointment to his Majesty the King"), gebraucht gekauft um
1972 in London. Optisch sehr gut und angenehm zu bedienen. Allerdings wurden
die Rollfilme langsam immer teurer, und Farbfilme erst recht, so dass nicht mehr
allzu viele Bilder damit entstanden sind.
Bild 77: Rolleiflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6cm aus den
1940er Jahren (wegen: "by appointment to his Majesty the King"), gebraucht gekauft um
1972 in London. Optisch sehr gut und angenehm zu bedienen. Allerdings wurden
die Rollfilme langsam immer teurer, und Farbfilme erst recht, so dass nicht mehr
allzu viele Bilder damit entstanden sind.
Cosina SLR mit PK-Objektiven
Meine erste Spiegelreflex-Kamera; die schlechten Erfahrungen mit diesem
Exemplar, bei dem, wie ich aus heutiger Sicht vermute, der Spiegel nicht
richtig justiert war, haben bei mir eine sehr reservierte Haltung gegenüber
Spiegelreflexkameras hinterlassen, und ich habe richtig aufgeatmet, als es mit
den Digitalkameras dann auch die ersten DSLRs gab, wo man solche mechanischen Fehler
durch die sofortige Bildkontrolle ja sofort sehen konnte - und nicht erst nach Stunden oder Tagen - , sowie besonders als es die
ersten spiegellosen sogenannten Systemkameras (also mit Wechselobjektiven) gab, bei dem man
dem manuellen- UND dem auto-Fokus gleichermassen trauen kann, selbst wenn der
Autofokus vielleicht etwas langsamer arbeitet als bei einer Spiegelreflexkamera.
Doch das gehört eigentlich zu den Kameradetails weiter unten!
Minox 35
Eine leicht weitwinkelige Miniatur-Kleinbildkamera mit automatischer
Belichtungssteuerung (man würde heute vom Av-Modus sprechen),
 allerdings ohne Entfernungsmesser.
Auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich das "Kamera immer dabei" gut
praktizieren konnte, denn sie passte zusammengeklappt sogar in die Hemd-Brusttasche.
allerdings ohne Entfernungsmesser.
Auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich das "Kamera immer dabei" gut
praktizieren konnte, denn sie passte zusammengeklappt sogar in die Hemd-Brusttasche.
Gegenüber der historisch bedeutsamen Agenten-Minox der 30er- bis 50er Jahre, dem
eigentlich bekanntesten Produkt, hatte diese "Minox 35" den
grossen Vorteil, den üblichen 36mm-Kleinbildfilm zu benutzen.
Porst SLR
Bild 78
 Dies war 2004 meine letzte real noch benutzte SLR-"Analog-Kamera", und noch
parallel zu der bereits gekauften Digitalkamera Canon Powershot A200 genutzt.
Ich habe auf Reisen oft mit beiden Kameras dasselbe Motiv photographiert,
besonders bei Landschaftsaufnahmen: Mit der Analog-SLR wegen der Qualität der
Bilder, und mit der A200 wegen des sofortigen Eindrucks.
Dies war 2004 meine letzte real noch benutzte SLR-"Analog-Kamera", und noch
parallel zu der bereits gekauften Digitalkamera Canon Powershot A200 genutzt.
Ich habe auf Reisen oft mit beiden Kameras dasselbe Motiv photographiert,
besonders bei Landschaftsaufnahmen: Mit der Analog-SLR wegen der Qualität der
Bilder, und mit der A200 wegen des sofortigen Eindrucks.
Meine heutigen Kameras
( all in use - and most of them bought "used" )
Warum so viele?
 Meine Meinung:
Wer in der Überfluss-Gesellschaft, mit ihrem exponentiellen Wachstumsdrang und
dem dadurch schnellen "Veralten" ihrer Produkte als Technik-freak mit gewisser
"Verzögerung" mitschwimmt,
indem er eben NICHT immer das Allerneueste haben muss, kann auf der
"Abfallseite" durchaus edle, noch gut brauchbare Teile herausmogeln,
besonders wenn er ein Bastler und Tüftler ist.
Das gilt zwar generell für Schrott, aber eben auch für Edelschrott, und damit für Digitalkameras,
die keineswegs so schnell unbrauchbar werden
wie sie als "veraltet" erscheinen mögen! Auch liegen Kameras bei
manchen Besitzern gerne jahrelang unbenutzt im Schrank. Natürlich gibt es bei realen
Angeboten auch Unterschiede, aber einige sind nach wie vor edle Vertreter ihrer Gattung.
.
Meine Meinung:
Wer in der Überfluss-Gesellschaft, mit ihrem exponentiellen Wachstumsdrang und
dem dadurch schnellen "Veralten" ihrer Produkte als Technik-freak mit gewisser
"Verzögerung" mitschwimmt,
indem er eben NICHT immer das Allerneueste haben muss, kann auf der
"Abfallseite" durchaus edle, noch gut brauchbare Teile herausmogeln,
besonders wenn er ein Bastler und Tüftler ist.
Das gilt zwar generell für Schrott, aber eben auch für Edelschrott, und damit für Digitalkameras,
die keineswegs so schnell unbrauchbar werden
wie sie als "veraltet" erscheinen mögen! Auch liegen Kameras bei
manchen Besitzern gerne jahrelang unbenutzt im Schrank. Natürlich gibt es bei realen
Angeboten auch Unterschiede, aber einige sind nach wie vor edle Vertreter ihrer Gattung.
.
In diesem Sinne: Bild 79 oben: Ort in Österreich, nähe Graz.
 Canon PowerShot A200 (Bild 81)
Canon PowerShot A200 (Bild 81)
 Um 2002 waren gute Digitalkameras für den Hobbyisten noch absolut
unerschwinglich. Einer der Gründe waren die enormen Herstellungskosten für die
Fotosensoren. Günstiger waren nur Kameras mit eher bescheiden auflösenden
Sensoren, wo 2 Megapixel ( 1600 pixel horizontal x 1200 vertikal) schon als
viel, fast ausreichend galten. Und mit Recht: Zwar war die dem entsprechende
Auflösung eines Films 35mm-Kleinbildfilms deutlich höher, aber was nutzte das,
wenn das Bild auf dem Film der konventionellen Kamera unglücklich belichtet oder
verwackelt/unscharf war, was man dann ja erst Tage später feststellen würde? Für
reale "Schnappschüsse", und wenn man nicht viel vergrössern wollte, waren diese
Digitalkameras okay (und sind es auch heute noch!), zumal eine gute
Belichtungssteuerung und ein Autofokus damals schon selbstverständlich waren.
Um 2002 waren gute Digitalkameras für den Hobbyisten noch absolut
unerschwinglich. Einer der Gründe waren die enormen Herstellungskosten für die
Fotosensoren. Günstiger waren nur Kameras mit eher bescheiden auflösenden
Sensoren, wo 2 Megapixel ( 1600 pixel horizontal x 1200 vertikal) schon als
viel, fast ausreichend galten. Und mit Recht: Zwar war die dem entsprechende
Auflösung eines Films 35mm-Kleinbildfilms deutlich höher, aber was nutzte das,
wenn das Bild auf dem Film der konventionellen Kamera unglücklich belichtet oder
verwackelt/unscharf war, was man dann ja erst Tage später feststellen würde? Für
reale "Schnappschüsse", und wenn man nicht viel vergrössern wollte, waren diese
Digitalkameras okay (und sind es auch heute noch!), zumal eine gute
Belichtungssteuerung und ein Autofokus damals schon selbstverständlich waren.
Die A200 hatte also nur 2 MegaPixel Auflösung, Objektiv 1/2.8 (kein
Zoomobjektiv), war aber mit 225 € (man rechnete dies so kurz nach der
Währungsumstellung immer sofort nach und erschrak über die 450 DM) gerade so
halbwegs erschwinglich. Spontan gekauft habe ich sie auf einer Reise allerdings
aus folgendem Grund: Der Fotohändler hatte die Daten der Kamera im Schaufenster
angegeben, unter anderem: Makrofähigkeit schon ab 5cm ! Das liess ich mir
vorführen, und ich konnte das gut gebrauchen, denn ich arbeitete damals öfters
in Bibliotheken, und konnte damit Zitate, Fundstellen usw. "schnell mal
abfotografieren". Erst im laufe der Zeit benutzte ich sie dann auch für
Blumenfotografie, und auf Reisen als Zweit- und "Sofortbildkamera". Acht Jahre
später habe ich dasselbe Modell auf einem Flohmarkt nochmals gebraucht gekauft. Nun für 5
€. Bei beiden musste ich inzwischen die Plastiklasche für die
Batteriefacharretierung durch eine aus Metall ersetzen. Hoch belastetes Plastik
hält halt nicht ewig....


Canon PowerShot A300, Bild 82
Ähnliche Kamera wie die A200, aber mit 3 Megapixel die 1.5-fache Auflösung, und
eine etwas praktischere Bedienung. Sie kostete ("nur noch") 130 €, hatte aber
statt F/2.8- nur ein F/3,6-Objektiv, was man bei Dämmerung usw. anhand von eher
verwackelten Aufnahmen schmerzlich feststellen musste. Die berühmte, manchmal
alles entscheidende "Eine-Blende"-Stufe eben. Dennoch hat auch diese Kamera als
Zusatz-Reisebegleiter gute Dienste geleistet.
Canon PowerShot Pro 1, Bild 83
 Im Jahr 2006 meine erste "richtige" Digitalkamera, die die Analogkameras
ersetzen sollte und dies auch einige Jahre tat. Ich hatte gesehen, wie ein
Berufsfotograf in der Nachbarschaft diese Kamera verwendete und sie als gut,
wenngleich teuer, bezeichnet hatte. Er hatte sie für 1200 € gekauft. Daten: 8
Megapixel, fest eingebautes Zoom-Objektiv mit weitem Bereich, Autofokus
abschaltbar. Als ich die Kamera dann im Lufthansa-Shop für 600 € angeboten sah,
habe ich sie gekauft. Mehrere Jahre habe ich sie auf Reisen benutzt. Dabei
stellten sich in Grenzsituationen doch einige Nachteile heraus: Die manuelle
Entfernungseinstellung war in praktischen Situationen zu umständlich zu
bedienen. Ausserdem erwies sich das Rauschverhalten als sehr begrenzend,(während
dies den Berufsfotografen in seinem Studio, wo immer ausreichend beleuchtet
werden konnte, natürlich nicht gestört hatte). Schon 400 ISO ergab
"furchtbare" Bilder. Der Fotosensor war eben doch zu klein und noch vom CCD-Typ.
Trotzdem hat diese Kamera "viele tausend" Bilder produziert.
Im Jahr 2006 meine erste "richtige" Digitalkamera, die die Analogkameras
ersetzen sollte und dies auch einige Jahre tat. Ich hatte gesehen, wie ein
Berufsfotograf in der Nachbarschaft diese Kamera verwendete und sie als gut,
wenngleich teuer, bezeichnet hatte. Er hatte sie für 1200 € gekauft. Daten: 8
Megapixel, fest eingebautes Zoom-Objektiv mit weitem Bereich, Autofokus
abschaltbar. Als ich die Kamera dann im Lufthansa-Shop für 600 € angeboten sah,
habe ich sie gekauft. Mehrere Jahre habe ich sie auf Reisen benutzt. Dabei
stellten sich in Grenzsituationen doch einige Nachteile heraus: Die manuelle
Entfernungseinstellung war in praktischen Situationen zu umständlich zu
bedienen. Ausserdem erwies sich das Rauschverhalten als sehr begrenzend,(während
dies den Berufsfotografen in seinem Studio, wo immer ausreichend beleuchtet
werden konnte, natürlich nicht gestört hatte). Schon 400 ISO ergab
"furchtbare" Bilder. Der Fotosensor war eben doch zu klein und noch vom CCD-Typ.
Trotzdem hat diese Kamera "viele tausend" Bilder produziert.
 Canon PowerShot A470
Bild 84
Canon PowerShot A470
Bild 84
 Gekauft für ca. 90 € und hauptsächlich für Video benutzt, wobei ich das Gebiet der Videofilmerei eigentlich nie richtig betreten habe. Ich liebe eher feststehende Bilder. Die A470 ist auch schon CHDK-fähig.
Später habe ich darauf soweit möglich immer bewusst geachtet.
Gekauft für ca. 90 € und hauptsächlich für Video benutzt, wobei ich das Gebiet der Videofilmerei eigentlich nie richtig betreten habe. Ich liebe eher feststehende Bilder. Die A470 ist auch schon CHDK-fähig.
Später habe ich darauf soweit möglich immer bewusst geachtet.
 Bild 85
Bild 85
 Canon PowerShot A 530.
Für unter 10€ gebraucht gekauft. Ist sehr viel einfacher aufgebaut als die unten folgende A570IS. Wird für Experimente benutzt.
Canon PowerShot A 530.
Für unter 10€ gebraucht gekauft. Ist sehr viel einfacher aufgebaut als die unten folgende A570IS. Wird für Experimente benutzt.
Bild 86 
 Canon PowerShot A 570 IS
Canon PowerShot A 570 IS
Nachdem ich für ca. 30€ auf einer Fotobörse die erste A570IS gebraucht gekauft hatte, war ich
so begeistert von dieser "Taschenknipse", die auch manuelle Steuerung erlaubt und eine richtige Irisblende hat (wenngleich nur bis F/8), dass ich später noch zwei weitere für 15 € und 5 € gekauft habe. Zur selben Zeit hatte ich CHDK entdeckt, und erstmals mit dieser Kamera auch ausprobiert. Warum sie so besonders billig war? Die Batteriefachabdeckung ist eine echte mechanisch-konstruktive Katastrophe. Ferner die Unfähigkeit, mit billigen Mignonzellen bzw. Akkus in der Praxis auch wirklich akzeptabel lange betrieben werden zu können. Eine bessere Lösung dieses Problems ergab sich erst viele Jahre später: Verwendung von Mignon-Zellen, die per innerem Spannungswandler aus einem inneren LiIon-Akku konstant je 1.5V liefern, und die per USB-B-Stecker geladen werden können. Für wichtige Fälle benutze ich diese Zellen; sonst oft, wo möglich, ein Netzteil 3.3V, oder selbstgebaute Stromversorgungen: Die USB-5V (aus einem Netzteil oder aus einer "power bank") werden per Schaltregler auf 3V herabgesetzt.
 Bild 87
Bild 87
 Canon PowerShot A 590 IS
Canon PowerShot A 590 IS
Entspricht weitgehend der A570IS, mit dem Vorteil, dass der Autofokus meist auf
Bildmitte gezwungen werden kann, und nicht eventuell irgendwo hinspringt, wo man
es nicht haben will, wie dies bei der A570IS manchmal passiert.
 Bild 88
Bild 88
 Canon PowerShot SX230
Canon PowerShot SX230
Für ca. 80€ gebraucht gekauft, hauptsächlich für GPS-Experimente. Hohe Auflösung, gutes Tele.

Bild 89
 Canon Digital IXUS 60
Canon Digital IXUS 60
Eine tolle, sehr kleine Taschenkamera zum "immer-dabei-haben". Belichtungssteuerung allerdings nur über die Verschlusszeit. Die Blende ist immer f/2.8, und der Zoombereich ist recht klein. Dennoch oft benutzt.
 Canon EOS 20 D
Bild 90
Canon EOS 20 D
Bild 90
 Nach Meinung von Neffe Jens (und mir) die erste akzeptable Canon DSLR, die ich deshalb
auch um 2013 gut erhalten für um 150 € zusammen mit einigen Canon Objektiven gebraucht gekauft habe. Der Fotosensor hat "nur" 8 Megaspixels wie die Powershot Pro 1, aber mit einem wesentlich besserem Rauschverhalten bis 1600 ISO, da der Bildsensor wesentlich grösser ist. Es gibt nur ein optisches Sucherbild, aber keinen "live view". Man fotografiert also noch klassisch, kann das Ergebnis aber nach der Aufnahme im Display begutachten.
Nach Meinung von Neffe Jens (und mir) die erste akzeptable Canon DSLR, die ich deshalb
auch um 2013 gut erhalten für um 150 € zusammen mit einigen Canon Objektiven gebraucht gekauft habe. Der Fotosensor hat "nur" 8 Megaspixels wie die Powershot Pro 1, aber mit einem wesentlich besserem Rauschverhalten bis 1600 ISO, da der Bildsensor wesentlich grösser ist. Es gibt nur ein optisches Sucherbild, aber keinen "live view". Man fotografiert also noch klassisch, kann das Ergebnis aber nach der Aufnahme im Display begutachten.

Canon EOS 50 D
Bild 91
 Für manche Aufnahmen soll die Qualität sehr viel besser sein als bei den Taschenkameras, und die unmittelbare Begutachtung des Bildes schon vor und während der Aufnahme soll auch möglich sein. Deshalb eine EOS 50D, 16 Megapixels Auflösung, auf "live view" umschaltbar, Autofokus-Feinabgleich möglich (hab ich aber noch nicht benötigt). Sie ist schwer wie ein Schlachtschiff. Natürlich passen alle Canon-Objektive (und einige Fremd-Objektive) hier, wie auch bei der folgenden EOS300D.
Für manche Aufnahmen soll die Qualität sehr viel besser sein als bei den Taschenkameras, und die unmittelbare Begutachtung des Bildes schon vor und während der Aufnahme soll auch möglich sein. Deshalb eine EOS 50D, 16 Megapixels Auflösung, auf "live view" umschaltbar, Autofokus-Feinabgleich möglich (hab ich aber noch nicht benötigt). Sie ist schwer wie ein Schlachtschiff. Natürlich passen alle Canon-Objektive (und einige Fremd-Objektive) hier, wie auch bei der folgenden EOS300D.

Canon EOS 300 D
Bild 92
 Diese Kamera habe ich für 37€ (ohne Objektiv) auf einer Fotobörse gebraucht gekauft, und bin von deren Bedienung und Zuverlässigkeit ganz begeistert. Das Gewicht ist kleiner als bei den beiden anderen DSLRs. Sie liegt gut in der Hand. Die Auflösung beträgt allerdings nur 6,3 Megapixel. Das reicht fürs Allerwelts-Knipsen durchaus, aber für höhere Ansprüche, und besonders das spätere Rausvergrössern, eher nicht.
Diese Kamera habe ich für 37€ (ohne Objektiv) auf einer Fotobörse gebraucht gekauft, und bin von deren Bedienung und Zuverlässigkeit ganz begeistert. Das Gewicht ist kleiner als bei den beiden anderen DSLRs. Sie liegt gut in der Hand. Die Auflösung beträgt allerdings nur 6,3 Megapixel. Das reicht fürs Allerwelts-Knipsen durchaus, aber für höhere Ansprüche, und besonders das spätere Rausvergrössern, eher nicht.
Die obengenannten Edelschrott- DSLRs" werden - das ist dem Alter geschuldet, und praktisch - alle mit demselben Akkutyp "311" betrieben.

-----------------------------------------------------------------
 Zum Spiegelreflexprinzip generell hier noch ein Erfahrungsbericht:
Zum Spiegelreflexprinzip generell hier noch ein Erfahrungsbericht:
Auch bei unverdächtigen Kameras wie z.B. meiner DSLR Canon EOS 300D sorgt der real vorhandene Unterschied von manueller Sucherbild-Scharfeinstellung zur tatsächlichen Bildschärfe auf dem Fotosensor für überraschende Ergebnisse: Anscheinend, wenn's auf tausendstel Millimeter ankommt, geht's dann doch manchmal schief:
Bild 93:
 Für eine Demo der (bekanntlich ja geringen) Schärfentiefe abhängig von einem ziemlich offenen Blendenwert hatte ich einen Blumenstrauss ausgewählt und, bei Blende F/1.2, laut Sucherbild scharfgestellt (auf das innere der Blüte rechts im Vordergrund).
Für eine Demo der (bekanntlich ja geringen) Schärfentiefe abhängig von einem ziemlich offenen Blendenwert hatte ich einen Blumenstrauss ausgewählt und, bei Blende F/1.2, laut Sucherbild scharfgestellt (auf das innere der Blüte rechts im Vordergrund).
Dann war ich aber entsetzt über die doch viel zu geringe Schärfe auch des angepeilten Details, siehe unten Bild 94 (links). (Anmerkung: Die folgenden 4 Bilder sind Ausschnittvergrösserungen)
Erst nach Abblenden auf F/4 war die grosse Blüte im Vordergrund akzeptabel abgebildet (und die Schärfentiefe ohnehin besser, was aber hier nicht gezeigt werden sollte), siehe rechtes Bild 95.

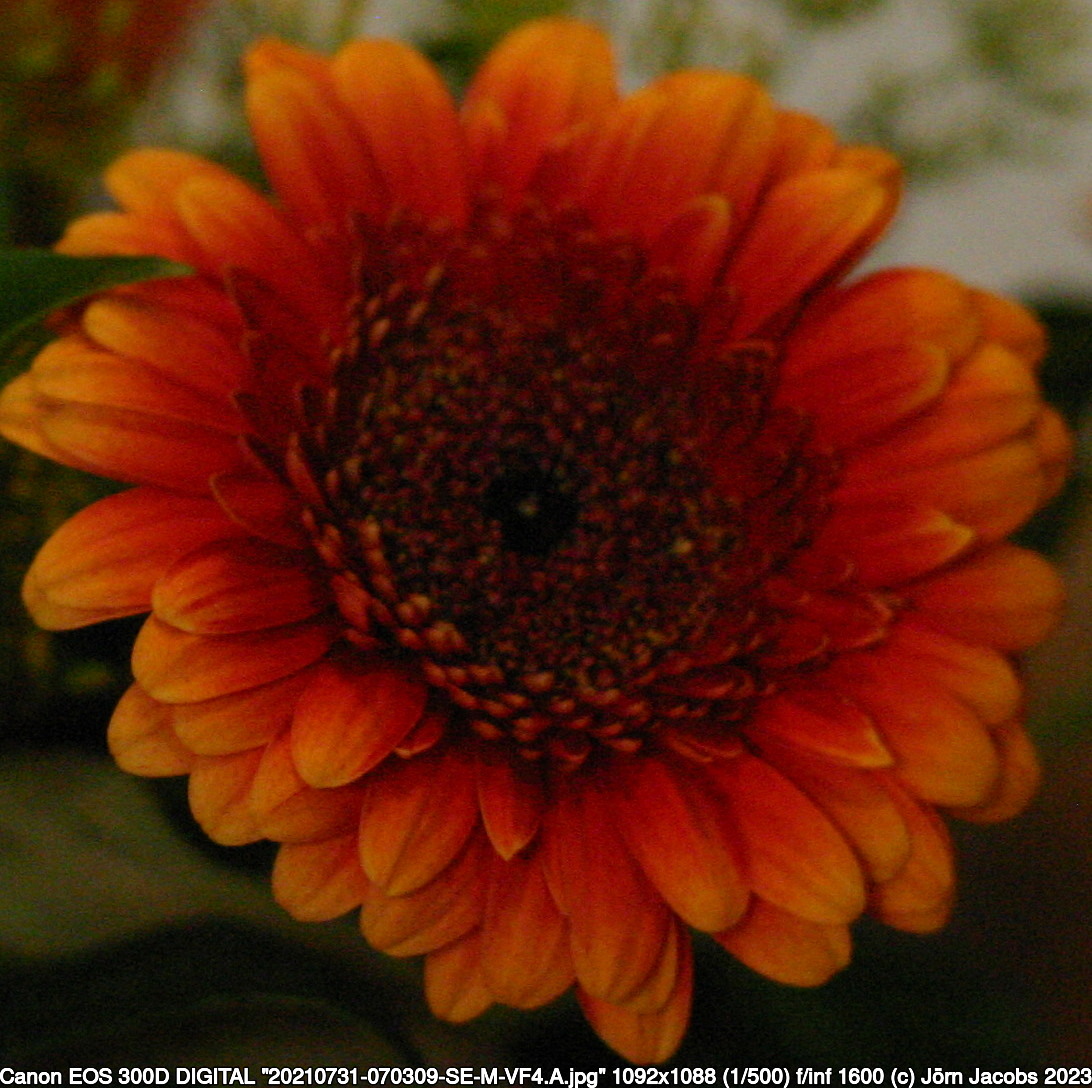
 Ich habe deshalb, das Sucherbild ignorierend, also blind,
"wider besseres Wissen", einige Aufnahmen mit jeweils geringfügig ansteigenden Entfernungseinstellungen gemacht, und siehe da: Gegenüber der ersten Aufnahme, Bild 94, oben
links, zeigt die beste Aufnahme dieser Serie eindeutig einen besseren Schärfeeindruck (siehe das Bild 96, unten links).
Ich habe deshalb, das Sucherbild ignorierend, also blind,
"wider besseres Wissen", einige Aufnahmen mit jeweils geringfügig ansteigenden Entfernungseinstellungen gemacht, und siehe da: Gegenüber der ersten Aufnahme, Bild 94, oben
links, zeigt die beste Aufnahme dieser Serie eindeutig einen besseren Schärfeeindruck (siehe das Bild 96, unten links).

 Darauf hin habe ich die Aufnahme wiederholt, mit immer noch demselben Objektiv, nun aber mit der live-view-Modus-fähigen Canon EOS 50D
(Bild vom Photosensor wird auf dem Display angezeigt) manuell laut dieser Displayanzeige scharfgestellt.
Das Bild 97,rechts zeigt nun die Blüte im Vordergrund auch sofort mit sehr guter Schärfe.
Das Objektiv ist also nicht der Sündenbock, sondern die SLR-Kameramechanik, die hier mit hineinfunkt.
Ältere DSLRs haben wegen des sonst wohl zu langsamen Autofokus keine andere Wahl, während die "Direktabbildungstechnik"
(also Verwendung des Bildsensors auch schon für die Scharfstellung) alle Probleme elegant umschiffen kann.
Darauf hin habe ich die Aufnahme wiederholt, mit immer noch demselben Objektiv, nun aber mit der live-view-Modus-fähigen Canon EOS 50D
(Bild vom Photosensor wird auf dem Display angezeigt) manuell laut dieser Displayanzeige scharfgestellt.
Das Bild 97,rechts zeigt nun die Blüte im Vordergrund auch sofort mit sehr guter Schärfe.
Das Objektiv ist also nicht der Sündenbock, sondern die SLR-Kameramechanik, die hier mit hineinfunkt.
Ältere DSLRs haben wegen des sonst wohl zu langsamen Autofokus keine andere Wahl, während die "Direktabbildungstechnik"
(also Verwendung des Bildsensors auch schon für die Scharfstellung) alle Probleme elegant umschiffen kann.
Ähnlich genial verhielten sich ja schon die alten Plattenkameras der vorletzten Jahrhundertwende, mit ihren für die Scharfeinstellung verwendeten Mattscheiben an exakt derselben Stelle wie die für die Aufnahme dann verwendeten Film-Platten.
 -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 Nun noch meine neuesten Kameras:
Nun noch meine neuesten Kameras:
 Canon EOS M10
Canon EOS M10
Bild 98: Eine tolle, hochauflösende (18 Megapixel) spiegellose, allerdings auch sucherlose Systemkamera, ebenfalls mit crop-Faktor 1.6, auf der mit einem aktivem Adapter, der also die Steuersignale
zwischen Kamera und Objektiv mitüberträgt, die allermeisten Autofokus-
und Zoomobjektive der oben beschriebenen "grossen" Canon-Kameras unmittelbar verwendbar sind, und dazu kompatible Fremdobjektive meistens auch. Wichtig: CHDK läuft in den meisten Funktionen, wie z.B. Bewegungserkennung, ebenfalls. Ich habe sie für 130€ gebraucht gekauft. Ich benutze sie gern mit dem Festbrennweiten-Objektiv 50mm/1:1.8 und mit 1600 ISO. Damit ist sie unschlagbar bei schlechten Lichtverhältnissen, und der Autofokus stimmt immer!
 Bild 99 und Bild 100: Panasonic Lumix G3,
Bild 99 und Bild 100: Panasonic Lumix G3,
eine spiegellose MFT-Systemkamera
(Crop-Faktor 2,0), links
mit einem Olympus 8mm-Fisheye-Objektiv, und rechts und mit einem
MFT-zu-M42-Adapter plus Zeiss Tessar 2.8/50 zu sehen. Die Lumix G3 habe ich recht günstig für 90€ gebraucht gekauft. Ich benutze sie oft mit manuell einstellbaren Objektiven. Das 8mm-Fisheye-Objektiv ist sehr flach, heisst deshalb etwas despektierlich auch "body cap lens" und macht sie zu einer hochqualitativen Taschenkamera.
 Die Adapter M42-auf-MFT, PK-auf-MFT und EOS-auf-MFT, wenn benutzt, vergrössern das Volumen der
Kamera" allerdings ganz gewaltig, siehe Bild.
Die Adapter M42-auf-MFT, PK-auf-MFT und EOS-auf-MFT, wenn benutzt, vergrössern das Volumen der
Kamera" allerdings ganz gewaltig, siehe Bild.



 Canon PowerShot SX4OHS, Bild 101 und Bild 102,
Canon PowerShot SX4OHS, Bild 101 und Bild 102,
eine aus ca. 2012 stammende mittelgrosse Kamera mit fest eingebautem Zoom-Objektiv, Auflösung 12 MegaPixel, und keinem allzu grossen Fotosensor (nur 6mm breit, aber immerhin CMOS, nicht CCD), aber einem für meine ausgedehnten Spaziergänge über die Wiesen und Felder der Rheinebene entscheidenden Vorteil: Sie hat einen (auf 35mm umgerechnet:) Zoombereich von 24mm bis 840mm, und der Bildstabilisator funktioniert auch bei den langen Brennweiten sehr ordentlich. Sie ist also wie geschaffen für Aufnahmen von entfernteren Tieren und unzugänglichen Pflanzen. Für 40 € als "Edelschrott" gut funktionsfähig 2021 gebraucht gekauft. Natürlich kann man auch CHDK verwenden; mal sehen, was ich damit noch so mache...

Bild 103 ist ein
 Beispiel für eine SX40-Freihand-Aufnahme, die sich sehen lassen kann: ISO 160, 1/200 sec, f/5.6, f=150 mm (entspr. 840 mm bei Vollformat), Entfernung ca. 30 m, Bildstabilisator.
Beispiel für eine SX40-Freihand-Aufnahme, die sich sehen lassen kann: ISO 160, 1/200 sec, f/5.6, f=150 mm (entspr. 840 mm bei Vollformat), Entfernung ca. 30 m, Bildstabilisator.
Motive,
""Gute Bilder"...so ziemlich alfabetisch geordnet...Jedes einzelne soll "mehr sagen als
1000 Worte". Schliesslich geht es hier ja um Hobby-Fotografie, oder?
Aktionsfotos (Bewegungsdarstellung, Start-Momente)
Bild 104:
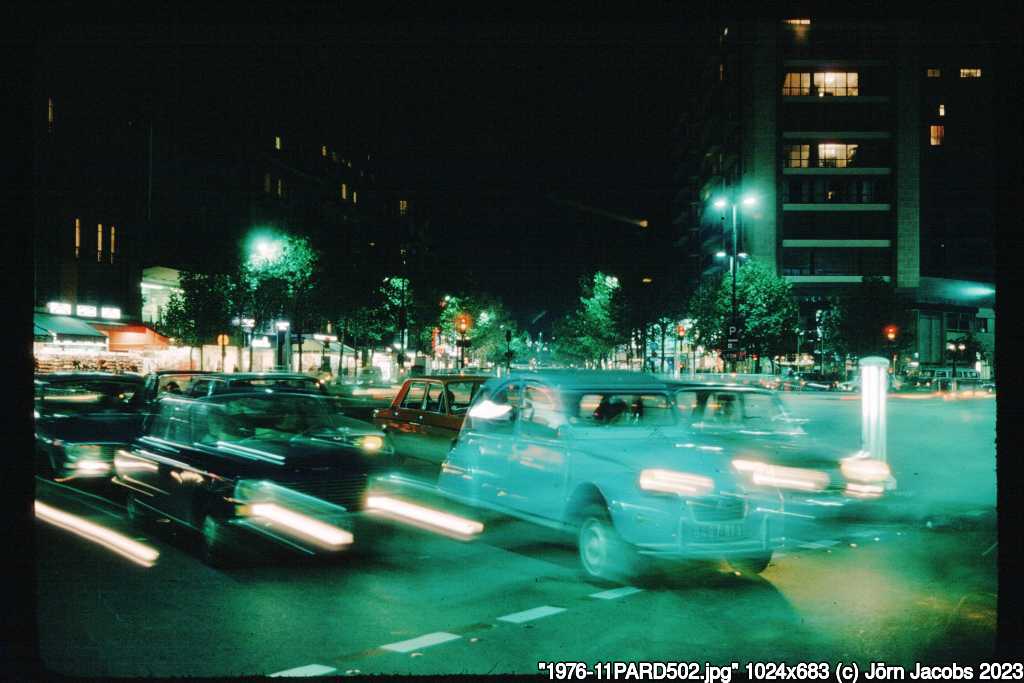
Stehende, dann startende Autophalanx, Paris 1976. Als Stativ diente sicherlich
ein Schaltkasten, eine Mauer o.ä. Manchmal hilft es übrigens auch, die Ecke
zwischen Kameragehäuse und Objektiv seitlich an eine nicht zu dicke
Stange (z.B. von einem Verkehrsschild) zu drücken. Ziel:
Es darf keinerlei Wackeln möglich sein, der Bildausschnitt
darf aber zur Not etwas schief sein.
Bilderüberlagerung
(FEHLT NOCH)
Dem Auge ungewohnte
Ultrakurzzeitaufnahmen
Bild 105
 April 2010, Brunnen in Berlin. Blende F/4.0, 1/400 s
April 2010, Brunnen in Berlin. Blende F/4.0, 1/400 s
 Bilder 106, 107, 108: Flackerndes Feuer, mit 1/500 s aufgenommen, friert die unstete Bewegung ein. Man könnte es fast anfassen, glaubt man.
Bilder 106, 107, 108: Flackerndes Feuer, mit 1/500 s aufgenommen, friert die unstete Bewegung ein. Man könnte es fast anfassen, glaubt man.


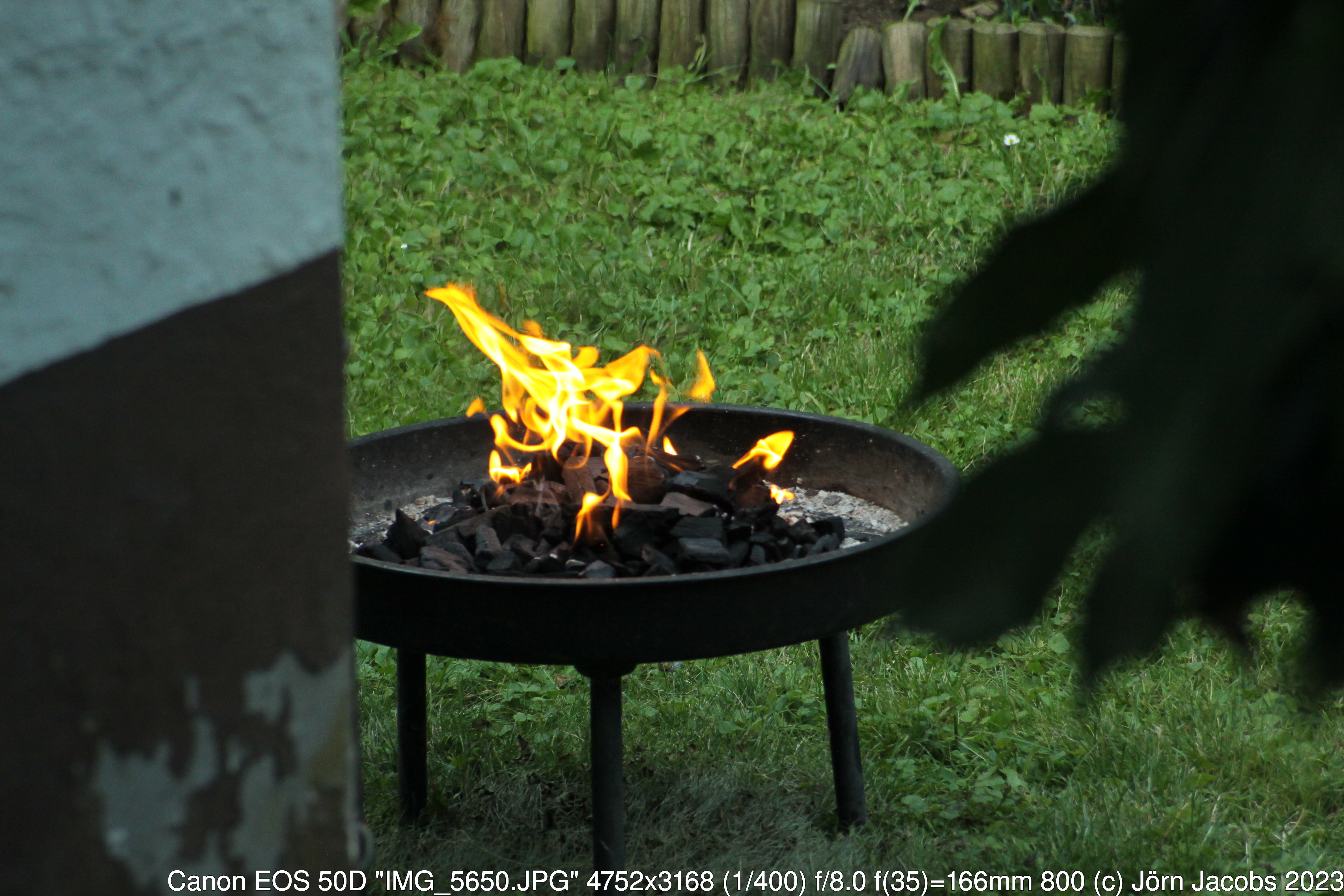


diverse Dokumentationen
 Bild 111
Bild 111
 "Mein Onkel "Wiete", Ingenieur bei den
Hamburger Stadtwerken, im Dienst in der völlig zerbombten Innenstadt. Repro eines Farbdias von 1944.
"Mein Onkel "Wiete", Ingenieur bei den
Hamburger Stadtwerken, im Dienst in der völlig zerbombten Innenstadt. Repro eines Farbdias von 1944.

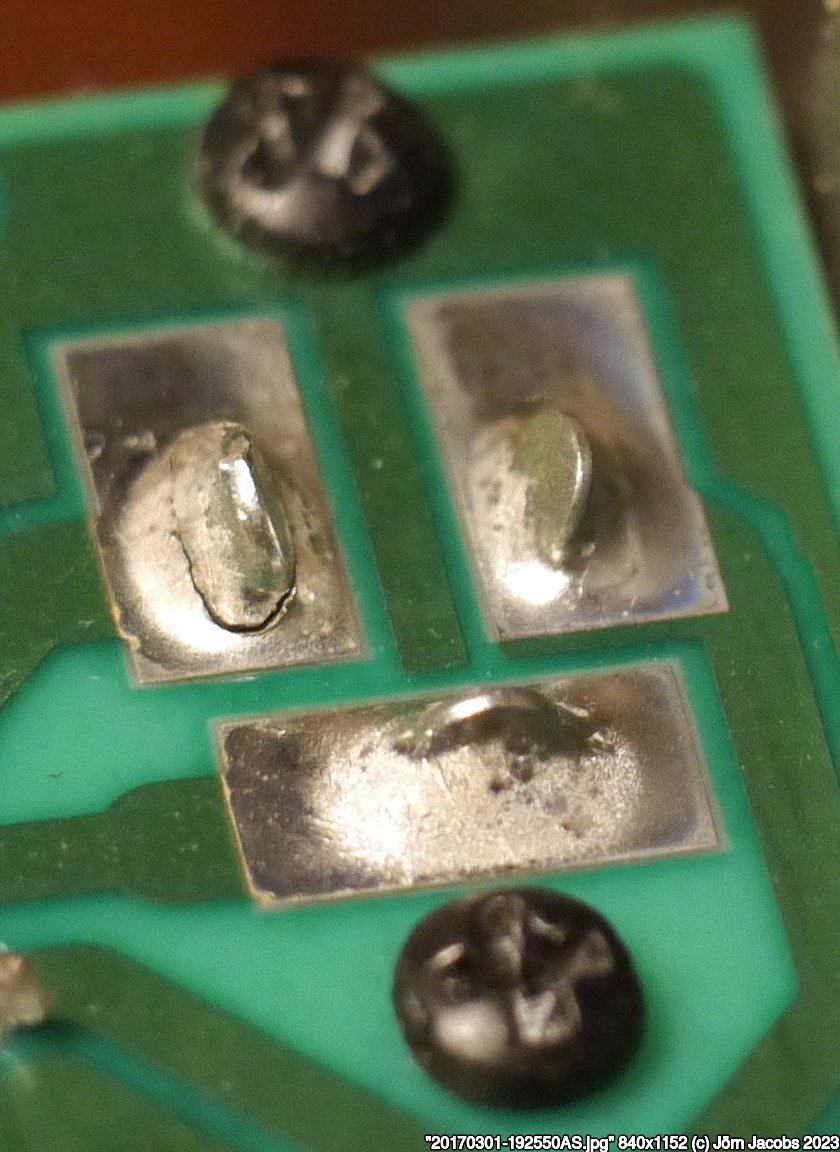 Bild 112 Eine durch Alterung und Eigenerwärmung defekte Lötstelle im Übergang vom Stromversorgungsstecker ("Hohlstecker") auf die Hauptplatine; Betriebsstrom 8 Jahre lang alle paar Tage etwa 700mA; Gerät: Synthesizer-Akkordeon.
Bild 112 Eine durch Alterung und Eigenerwärmung defekte Lötstelle im Übergang vom Stromversorgungsstecker ("Hohlstecker") auf die Hauptplatine; Betriebsstrom 8 Jahre lang alle paar Tage etwa 700mA; Gerät: Synthesizer-Akkordeon.
 Bild 113
Bild 113
 Da hatte jemand vor vielen Jahren die Rolladenkastenverkleidung mit einer gar zu langen Spax-Schraube befestigt. Irgendwann wollte der Laden
dann "
nimmer rolle"!
Da hatte jemand vor vielen Jahren die Rolladenkastenverkleidung mit einer gar zu langen Spax-Schraube befestigt. Irgendwann wollte der Laden
dann "
nimmer rolle"!

Exotisches
(...damals..., auch ein wenig persönliche Nostalgie)
 Bild 114
Bild 114
 Illumination in Columbia, S.C. Dez. 2007
Illumination in Columbia, S.C. Dez. 2007
 Bild 115
Bild 115
 Fremdes Helsinki/Helsingfors April 1975
Fremdes Helsinki/Helsingfors April 1975
Bild 116
 Wiedergesehenes Kopenhagen 1975
Wiedergesehenes Kopenhagen 1975
 Bild 117
Bild 117
 Paris 1975, Avenue des Champs-Elysees bei Nacht und Regen; die grünliche Färbung ist die Reaktion des Kodachrome-Diafilms auf die damals übliche Strassenbeleuchtung mit Quecksilberdampflampen; heute sind diese damaligen "Stromspar-Lampen" und ihre besondere Spektralverteilung so gut wie verschwunden.
Paris 1975, Avenue des Champs-Elysees bei Nacht und Regen; die grünliche Färbung ist die Reaktion des Kodachrome-Diafilms auf die damals übliche Strassenbeleuchtung mit Quecksilberdampflampen; heute sind diese damaligen "Stromspar-Lampen" und ihre besondere Spektralverteilung so gut wie verschwunden.
Bild 118: Erste Reise nach New York, 1981,
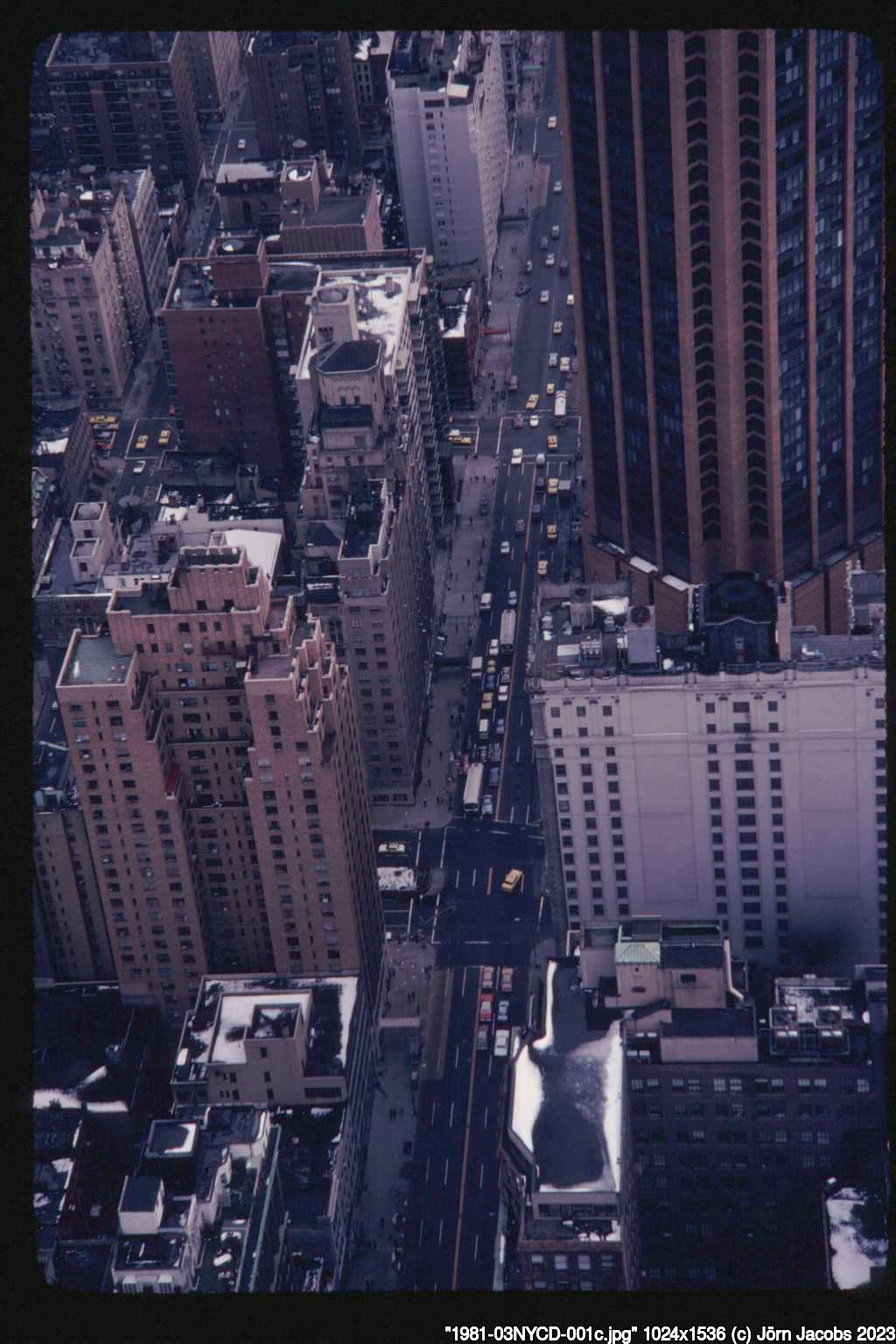
 Bild 119 : Hongkong 1983; alle Bilder dieser Jahre mit Retina IIc und Diafilm
Kodachrome 25 aufgenommen.
Bild 119 : Hongkong 1983; alle Bilder dieser Jahre mit Retina IIc und Diafilm
Kodachrome 25 aufgenommen.
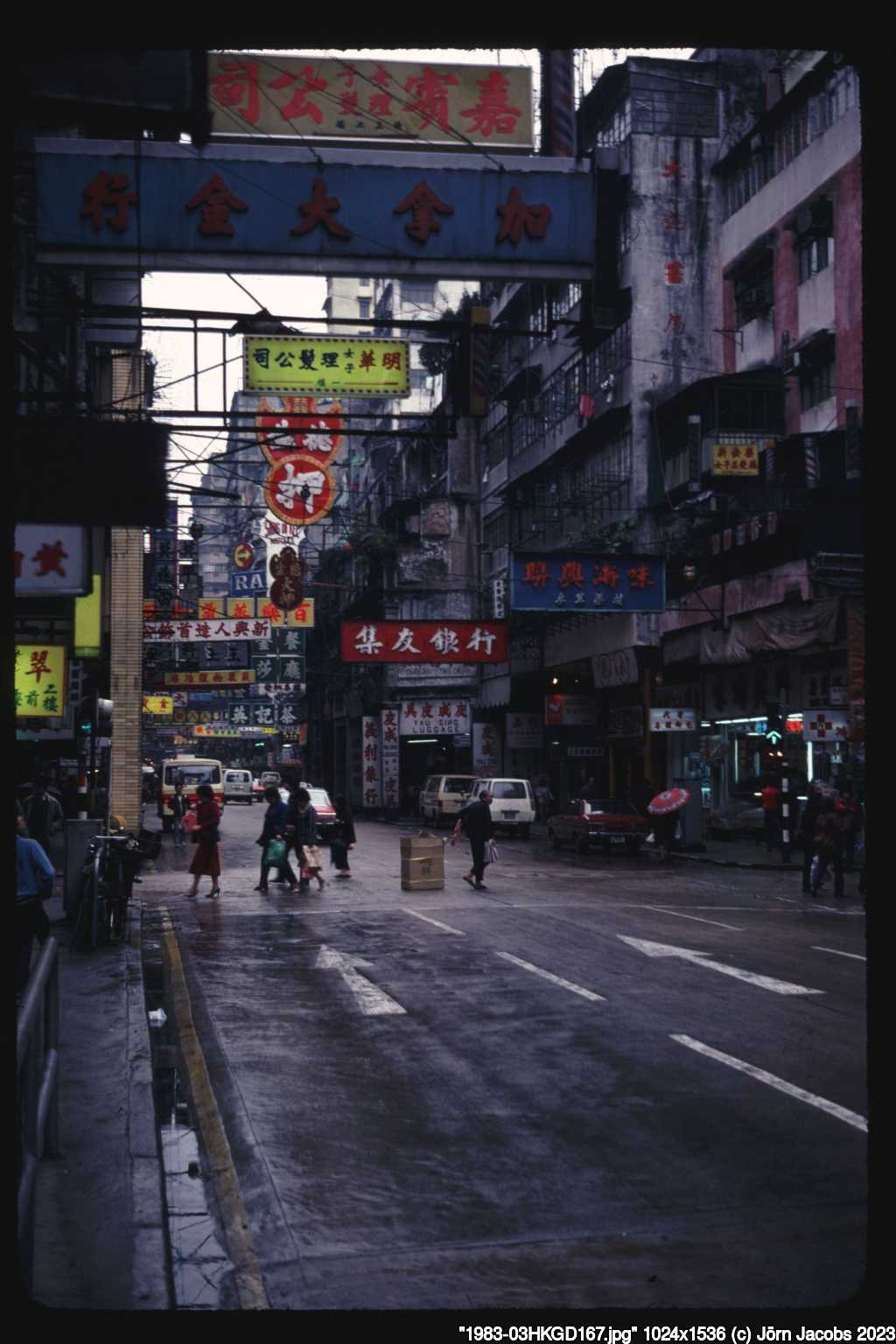
 Bild 120: Tokyo (Shinjuku), 1983
Bild 120: Tokyo (Shinjuku), 1983
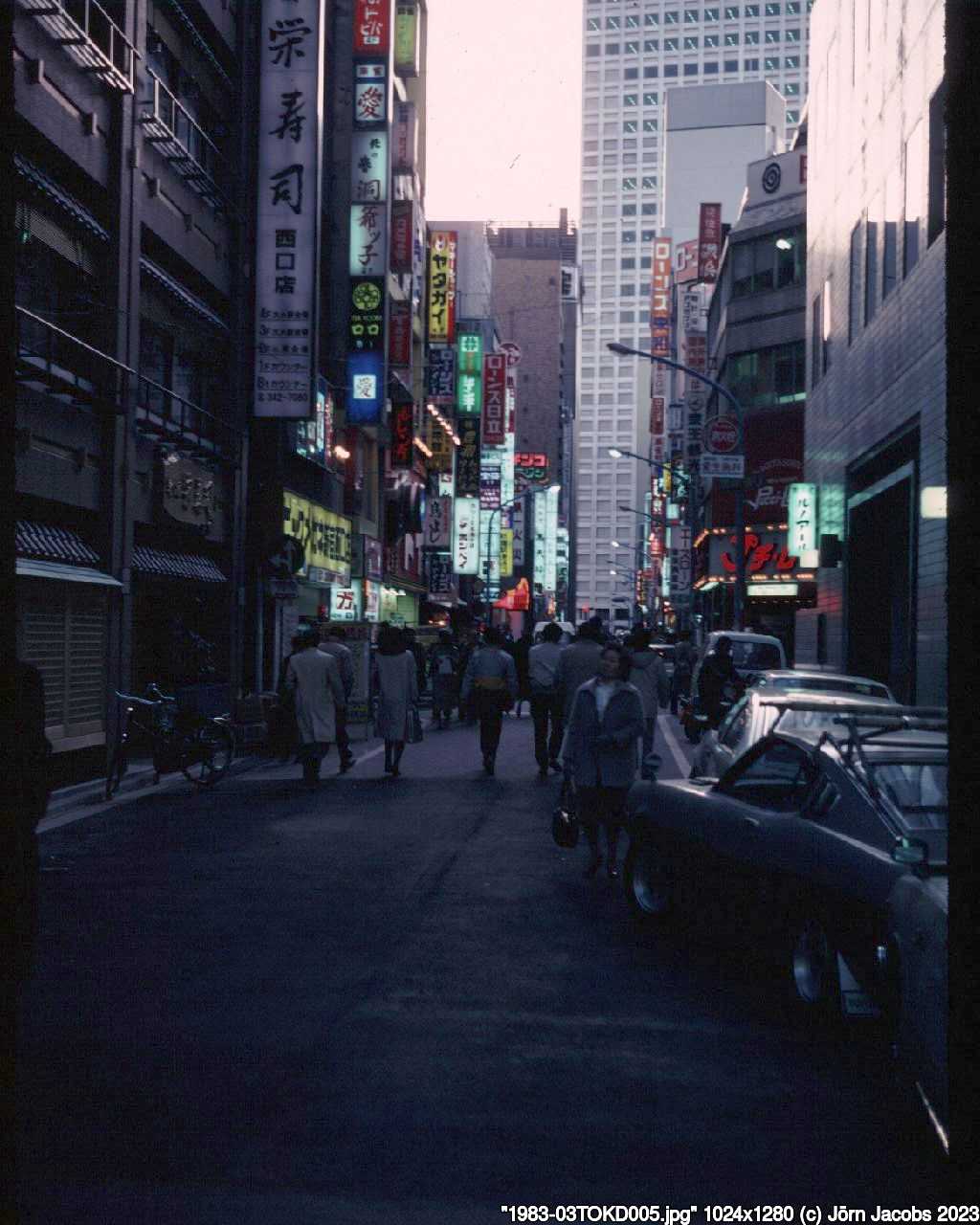

 Bild 121: Tokyo (Shinjuku), mit Bahnschranken aus Bambus. Einige Jahre später gab es an dieser Stelle ein mächtiges Betonviadukt für die Bahn.
Bild 121: Tokyo (Shinjuku), mit Bahnschranken aus Bambus. Einige Jahre später gab es an dieser Stelle ein mächtiges Betonviadukt für die Bahn.

Fotomontagen
 Bild 134 zeigt das bekannte Flugzeug Ju 52 in der Museums-Halle Sinsheim, aufgenommen 2007.
Bild 134 zeigt das bekannte Flugzeug Ju 52 in der Museums-Halle Sinsheim, aufgenommen 2007.
 Erstes Problem: Die Bildwinkelgrösse war durch das Objektiv der Kamera fest vorgegeben. Canon A300: Eingebaute Festbrennweite F/3.6, 5 mm (entspricht 32mm bei 50mm-Objektiven), Bel.-Zeit 0.4 s, Kamera fest aufgesetzt. Ich konnte aber nicht weiter zurückgehen, denn ich
stand auf einem schmalen Besuchersteg, und konnte das Flugzeug also nicht
in voller Breite erfassen. Lösung: Teilaufnahmen gemacht und mit einem
Panorama-Programm zusammengesetzt.
Erstes Problem: Die Bildwinkelgrösse war durch das Objektiv der Kamera fest vorgegeben. Canon A300: Eingebaute Festbrennweite F/3.6, 5 mm (entspricht 32mm bei 50mm-Objektiven), Bel.-Zeit 0.4 s, Kamera fest aufgesetzt. Ich konnte aber nicht weiter zurückgehen, denn ich
stand auf einem schmalen Besuchersteg, und konnte das Flugzeug also nicht
in voller Breite erfassen. Lösung: Teilaufnahmen gemacht und mit einem
Panorama-Programm zusammengesetzt.
Da nun das Flugzeug so schön auf mich zuzusegeln schien (die Motoren/Propeller drehten sich ja nicht...), wollte ich es, so wie es war, in die
Natur zurückversetzen. Ich hatte noch von früher ein schönes Photo vom
Ammersee, 1997 aufgenommen, das mir passend erschien; das habe ich digital
abfotografiert und als Hintergrund verwendet:
Bild 135


 Das Flugzeug habe ich in mühevoller Kleinarbeit von seinem alten Museums-Hintergrund freigestellt, und dann dem See überlagert.
Das Flugzeug habe ich in mühevoller Kleinarbeit von seinem alten Museums-Hintergrund freigestellt, und dann dem See überlagert.
Bild 136



Voilà!:
Bild 137



Gelungenes:
Bild 139
 Århus 2018: Seefahrtsromantik
Århus 2018: Seefahrtsromantik
Glorifizierendes
 Bild 140
Bild 140
 Paris 1978 (CNET, Issy-les-Moulineaux). Auch steinerne Engel können fliegen!
Paris 1978 (CNET, Issy-les-Moulineaux). Auch steinerne Engel können fliegen!

Kleines und Grosses auf einem Bild
--eigentlich die Domäne der (Super)-Weitwinkel-Objektive--
Bild 143


Bild 144
 Was ist grösser? Edinger Wasserturm versteckt sich hinter einer Pflanze
Was ist grösser? Edinger Wasserturm versteckt sich hinter einer Pflanze
 .
.
Bild 145: Wer ist grösser? Hochspannungsmast oder Mannheimer Fernmeldeturm
 Bild 146
Bild 146
 Berlin Mitte, 2003. Neptun piekst den Fernmeldeturm am Alexanderplatz.
Berlin Mitte, 2003. Neptun piekst den Fernmeldeturm am Alexanderplatz.

momenttypische Aufnahmen
 Bild 147
Bild 147
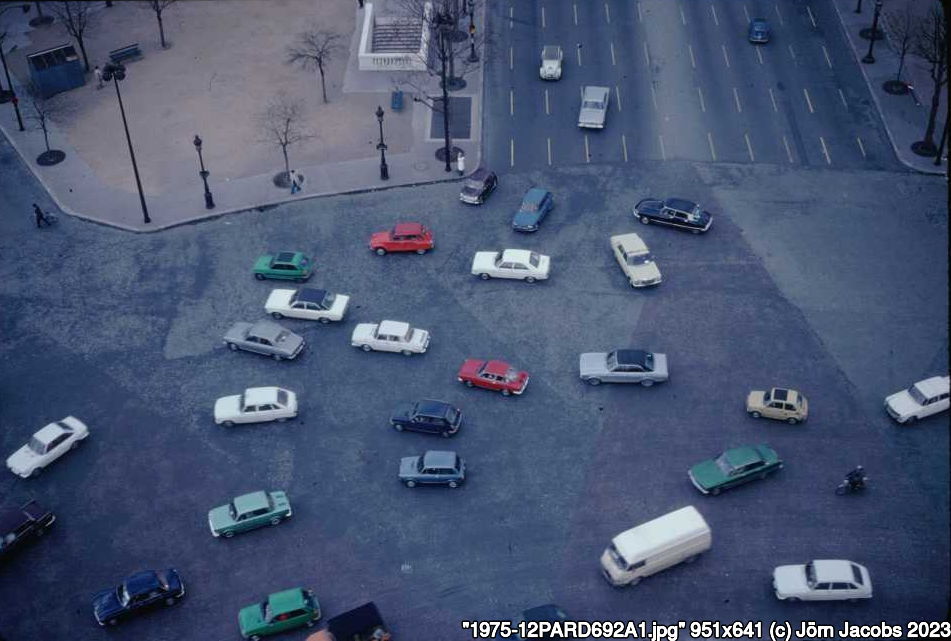 Vom Arc de Triomphe herab das Verkehrsgewühl mit "priorité de droite" (Rechts-vor-Links) auf dem Place d'Étoile: Paris 1975.
Vom Arc de Triomphe herab das Verkehrsgewühl mit "priorité de droite" (Rechts-vor-Links) auf dem Place d'Étoile: Paris 1975.

Panoramabildmontage trotz bewegter Personen
Bild 148
 Lange Exponate im Museum.
Lange Exponate im Museum.
 Bild 149
Bild 149
 ""Unser Wohnzimmer 2019". 360-Grad-Aufnahme. Ich bin 4-mal abgebildet.
""Unser Wohnzimmer 2019". 360-Grad-Aufnahme. Ich bin 4-mal abgebildet.
 Bastei,2006: Kantige Formen und runde Formen.
Bastei,2006: Kantige Formen und runde Formen.

gewöhnliche Perspektiven
Bild 151

 Links: Hier scheinen Menschen über das Wasser zu laufen. Die Erklärung hierzu ist das Bild nebenan, Bild 152: Die Stadt Århus hat einen tollen, runden Spazierweg auf dem Meer angelegt, nur wenig höher als der in der Ostsee ja fast konstante Meeresspiegel. Er wird gern beschritten. Eine schöne Idee!
Links: Hier scheinen Menschen über das Wasser zu laufen. Die Erklärung hierzu ist das Bild nebenan, Bild 152: Die Stadt Århus hat einen tollen, runden Spazierweg auf dem Meer angelegt, nur wenig höher als der in der Ostsee ja fast konstante Meeresspiegel. Er wird gern beschritten. Eine schöne Idee!

ungewöhnliche Perspektiven
Bild 153, Reston,
 Washington, D.C. April 2006, Laus auf Appartmenthaus-Balkongeländer, im 6.Stock.
Washington, D.C. April 2006, Laus auf Appartmenthaus-Balkongeländer, im 6.Stock.
 Bild 154
Bild 154
 Barcelona 2007. Blick morgens vom Hotelfenster im 6.Stock auf die Strasse.
Bild 155
Barcelona 2007. Blick morgens vom Hotelfenster im 6.Stock auf die Strasse.
Bild 155

 Der "kleine" Frankfurter Hauptbahnhof, 2006, aus einer Bank-Hochhaus-Perspektive.
Der "kleine" Frankfurter Hauptbahnhof, 2006, aus einer Bank-Hochhaus-Perspektive.
 Bild 156
Bild 156
 Kolpingstrasse, Edingen, 2018 und 2021, aus der Perspektive unserer beiden Hunde
Kolpingstrasse, Edingen, 2018 und 2021, aus der Perspektive unserer beiden Hunde
 Bild 157
Bild 157
 und einer Laus:
und einer Laus:
 Bild 158
Bild 158
 sowie eines tieffliegenden Insekts.
sowie eines tieffliegenden Insekts.


 Bild 159: Eine ganz tolle Perspektiven-Idee in Århus, 2018: Dieser als ein Farbverlauf
verglaste Rundgang mit Blick über die Stadt und die jütländische Landschaft,
Bild 160,
Bild 159: Eine ganz tolle Perspektiven-Idee in Århus, 2018: Dieser als ein Farbverlauf
verglaste Rundgang mit Blick über die Stadt und die jütländische Landschaft,
Bild 160,
 ermöglicht es, die "Welt" in ganz verschiedenen Färbungen zu betrachten: Die
jeweils sich einstellende Stimmung ändert sich alle paar Schritte! Zum Aufbau siehe das kleine Bild unten:
ermöglicht es, die "Welt" in ganz verschiedenen Färbungen zu betrachten: Die
jeweils sich einstellende Stimmung ändert sich alle paar Schritte! Zum Aufbau siehe das kleine Bild unten:
So sieht es von der Strasse aus:

Bild 161 und Bild 162:

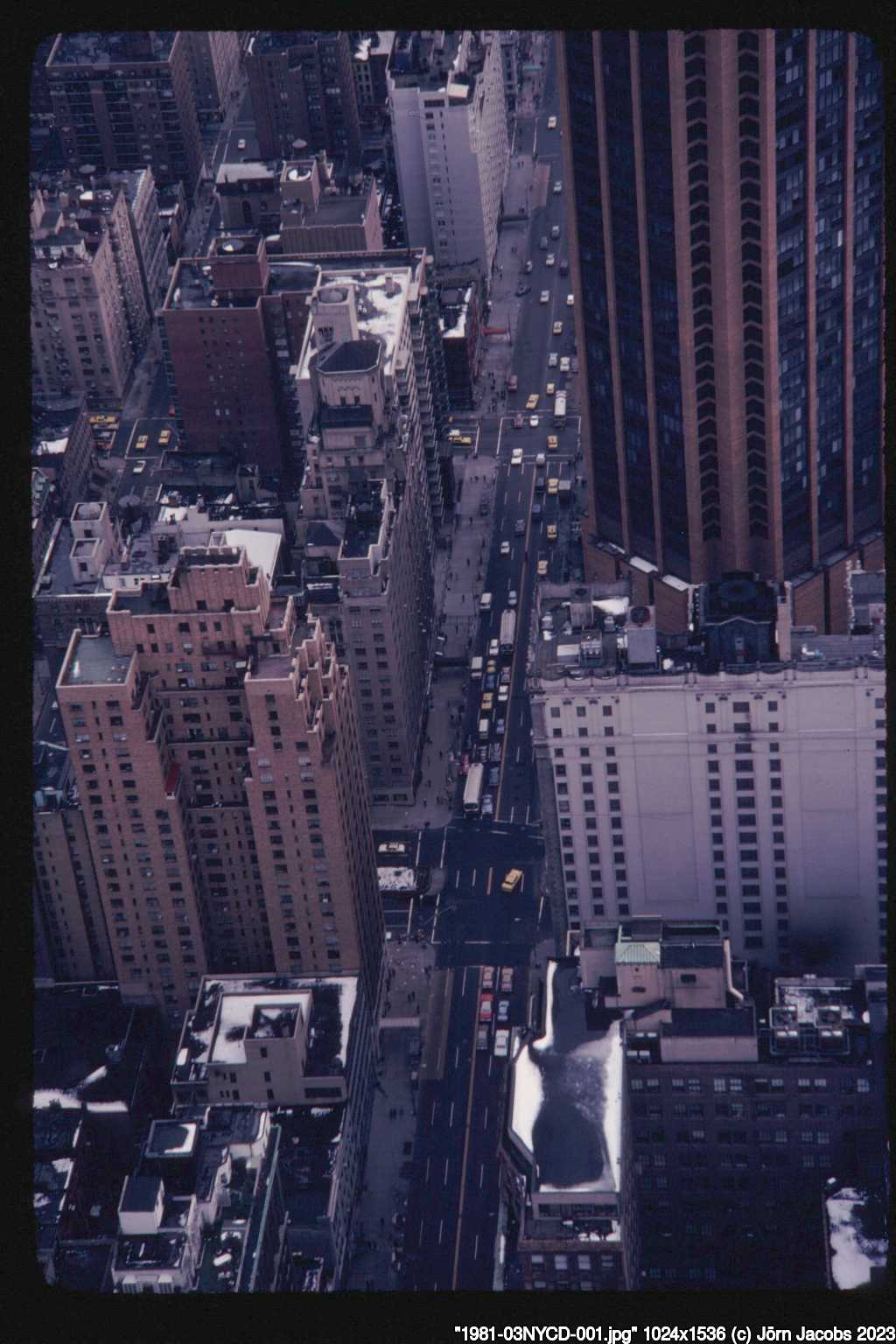
 Wie sich die Bilder entsprechen! Links: Manhattan,N.Y., 1981 real, aufrecht, und
rechtes Bild: An der Decke hängende Metall-Plastik, Århus,Gebäude DOKK1, 2018.
Wie sich die Bilder entsprechen! Links: Manhattan,N.Y., 1981 real, aufrecht, und
rechtes Bild: An der Decke hängende Metall-Plastik, Århus,Gebäude DOKK1, 2018.

Proportionen und Entfernungsrelationen bei Teleobjektiv-Aufnahmen (dem Einheimischen irreal vorkommend):
Bild 163
 Rheinstrasse Darmstadt, 2010. Die Entfernung vom Standort bis zum Schloss am Ende der Strasse ist mehr als 1 km!
Rheinstrasse Darmstadt, 2010. Die Entfernung vom Standort bis zum Schloss am Ende der Strasse ist mehr als 1 km!
Bild 165

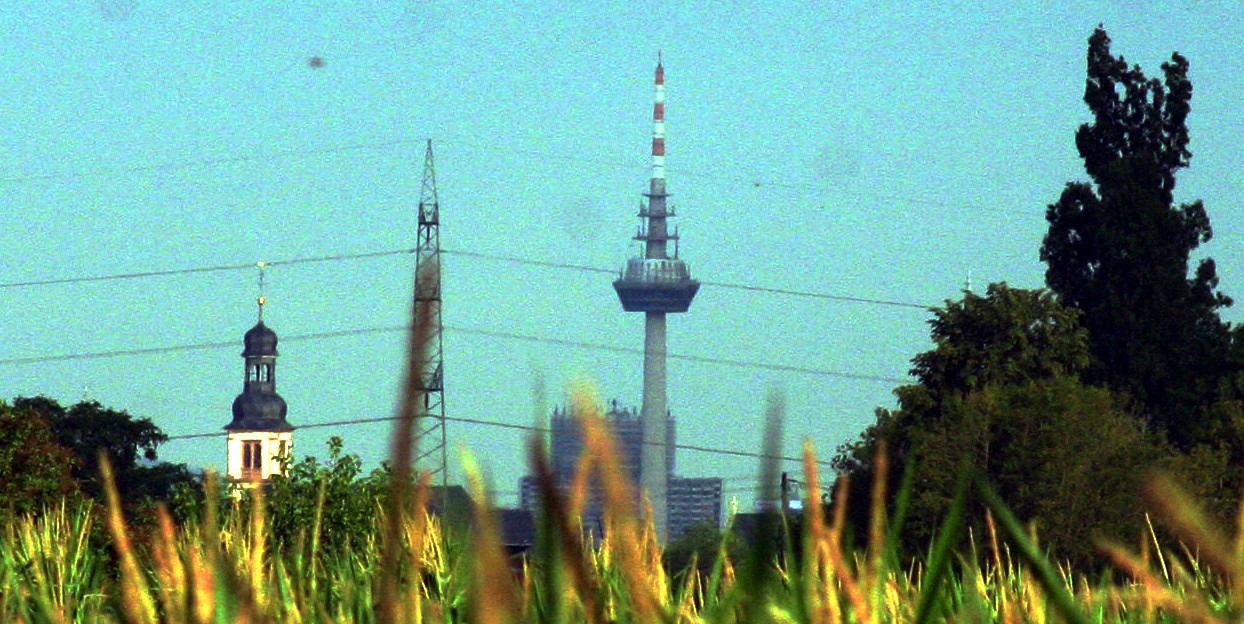 Von Edingen, nähe neuer Sportplatz, mit starkem Tele aufgenommen: Kamera: Canon EOS300D, 1/1000 s, F/13, 200mm (35mm: 320mm), ISO 800, Ausschnitt.
Von Edingen, nähe neuer Sportplatz, mit starkem Tele aufgenommen: Kamera: Canon EOS300D, 1/1000 s, F/13, 200mm (35mm: 320mm), ISO 800, Ausschnitt.
v.l.n.r.:
Kirche in Seckenheim, ca 4 km entfernt, dann Hochspannungsmast, ca.1 km entfernt, und Fernmeldeturm am Luisenpark in Mannheim, ca 15 km entfernt.
Bild 166



Schöne Dinge
Bild 167: Obststand auf Mallorca (?), 2003

 Bild 168
Bild 168
 Sicherlich ein schönes Foto...
Sicherlich ein schönes Foto...
Was bei einfachen Kameras,
die immer mit
Offenblende (aber gutem Autofokus) arbeiten, oder bei "besseren" Kameras,
die wegen zu wenig Licht aufblenden, zu einer hier ja gewünschten starken
Betonung der Blume führt, liesse die Kamera bei einem grossflächig-rundlichen
blühenden Busch kläglich versagen,
denn die Schärfentiefe würde bei weitem nicht ausreichen.
Canon PowerShot Pro1, F/3.5, 1/30 s
Bild 169
 Es sei denn, man geht sehr weit weg und verzichtet auf die Details.
Das ist hier sicherlich angebracht: Blumen-Tier in Bilbao, 2010. Na gut, dies hier
ist ein unpassendes Extrem-Gegenbeispiel (;-).
Es sei denn, man geht sehr weit weg und verzichtet auf die Details.
Das ist hier sicherlich angebracht: Blumen-Tier in Bilbao, 2010. Na gut, dies hier
ist ein unpassendes Extrem-Gegenbeispiel (;-).

* Blumen
Ein spezielles Kapitel, einfach eine hommage an die Schönheit der Formen und Farben in diesem Bereich der Natur:
Kapitel "Blumen":click here!




* schöne Menschen als "Scheinbilder"

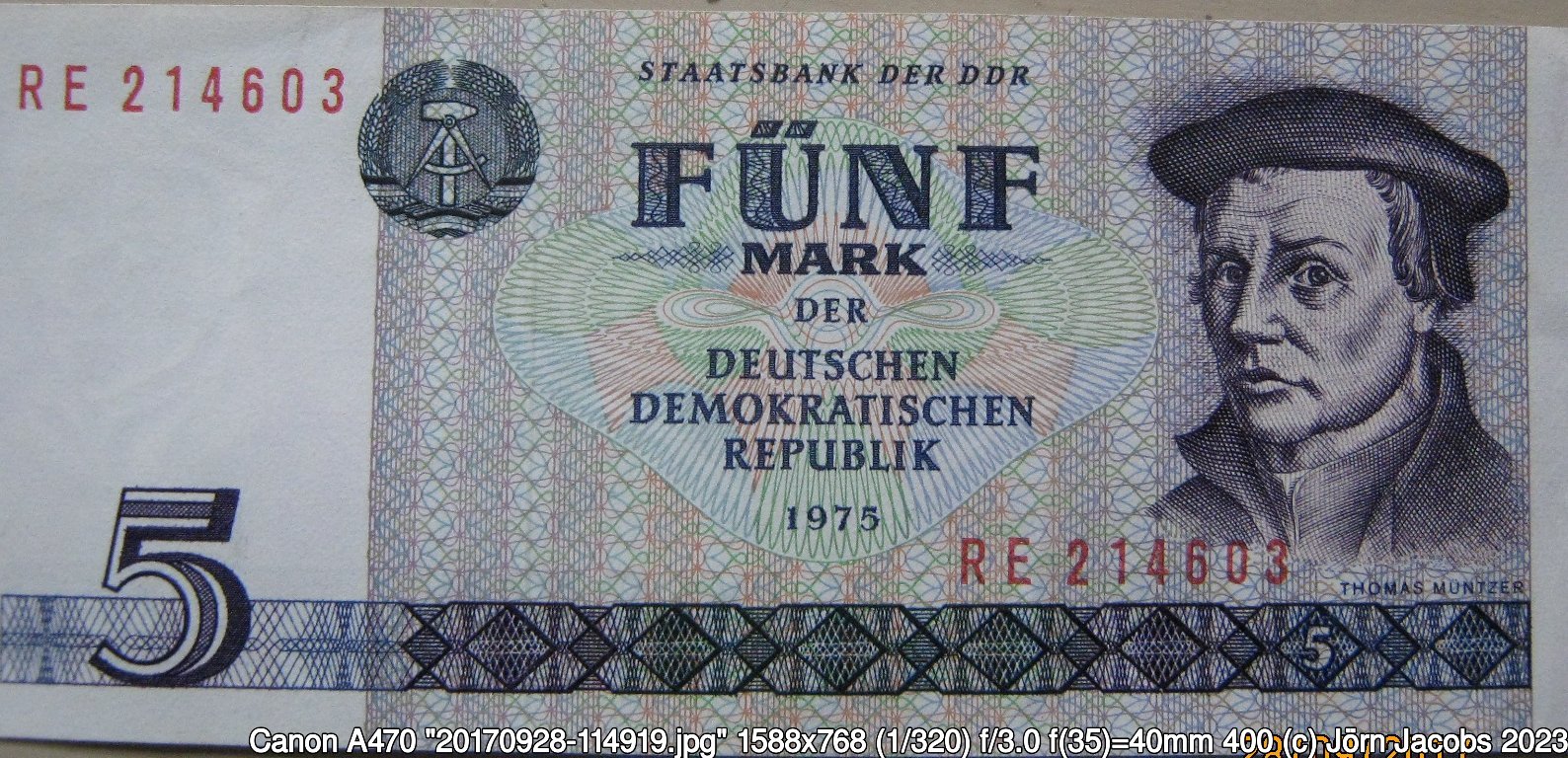

* Gebäude, Denkmäler, auch Naturdenkmäler

Denkmäler
Bild 109
 Breslau (Wrocław). Teilansicht des Denkmals über den Bevölkerungswechsel nach 1945.
Breslau (Wrocław). Teilansicht des Denkmals über den Bevölkerungswechsel nach 1945.

 Bild 231:Grosse Moschee in Dubai, 2008. Die Wüste geht bis ans Meer,
deshalb Bewölkung. Aber es regnet nur äusserst selten.
Bild 231:Grosse Moschee in Dubai, 2008. Die Wüste geht bis ans Meer,
deshalb Bewölkung. Aber es regnet nur äusserst selten.
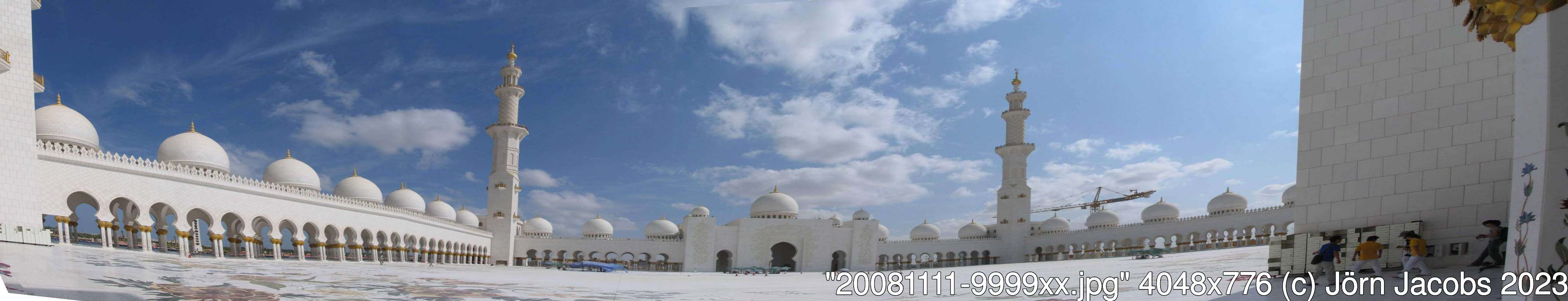 Bild 232: Grand Canyon, 2004
Bild 232: Grand Canyon, 2004
 Bild 233: Monument Valley, 2004
Bild 233: Monument Valley, 2004
 Bild 234: Bryce Canyon (?) 2004
Bild 234: Bryce Canyon (?) 2004
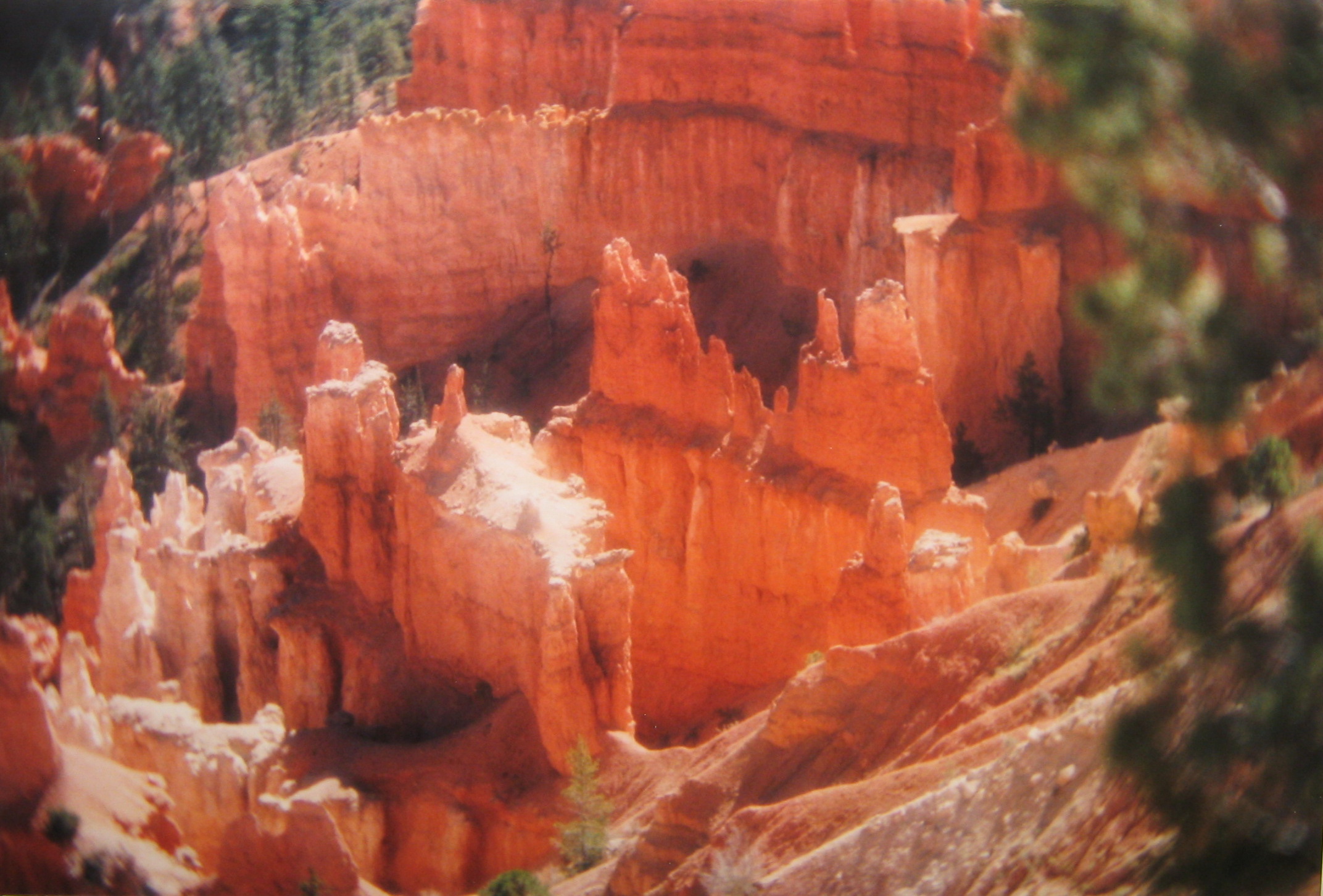
 Bild 235
Bild 235
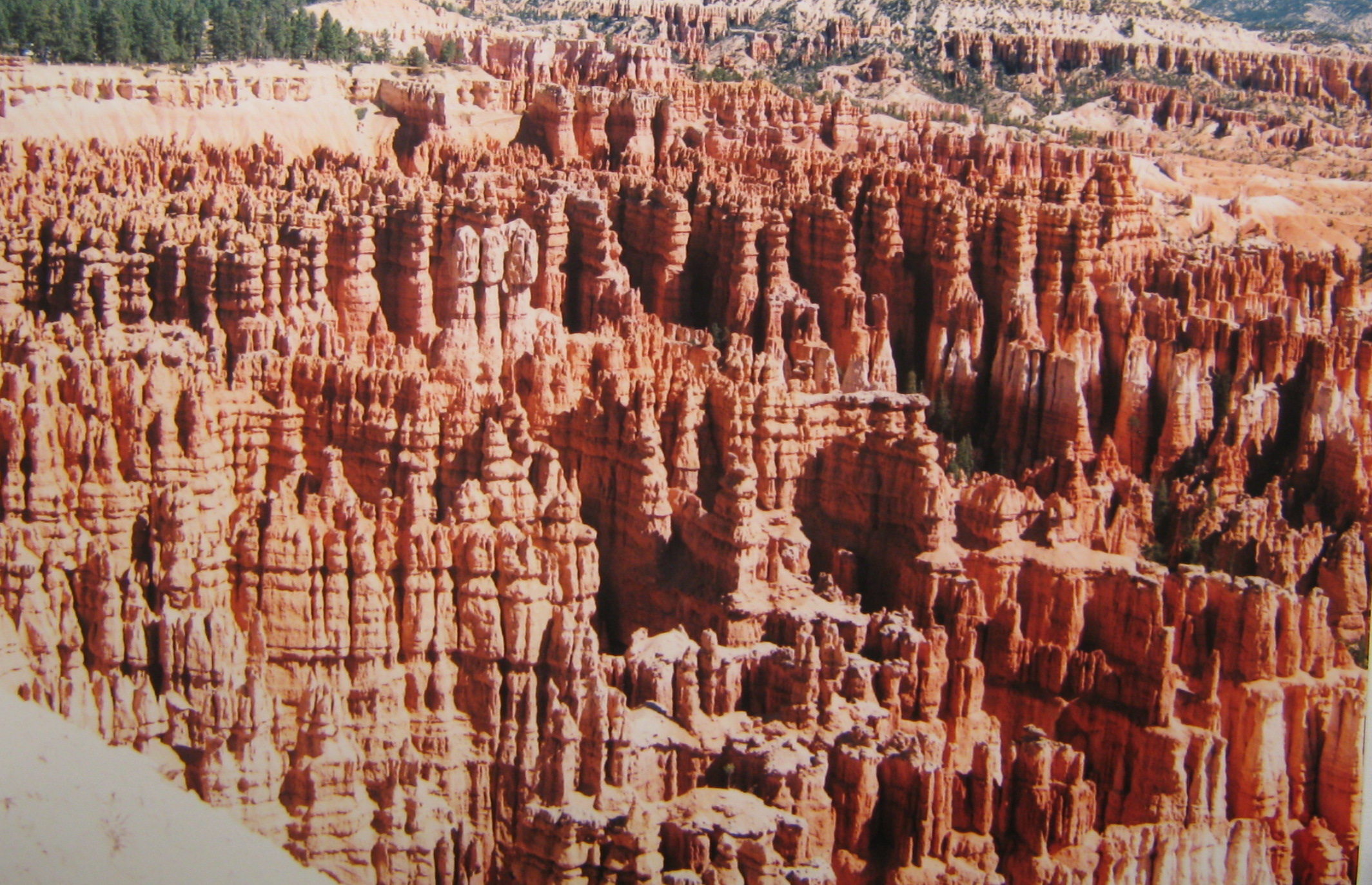
 Bild 236
Bild 236
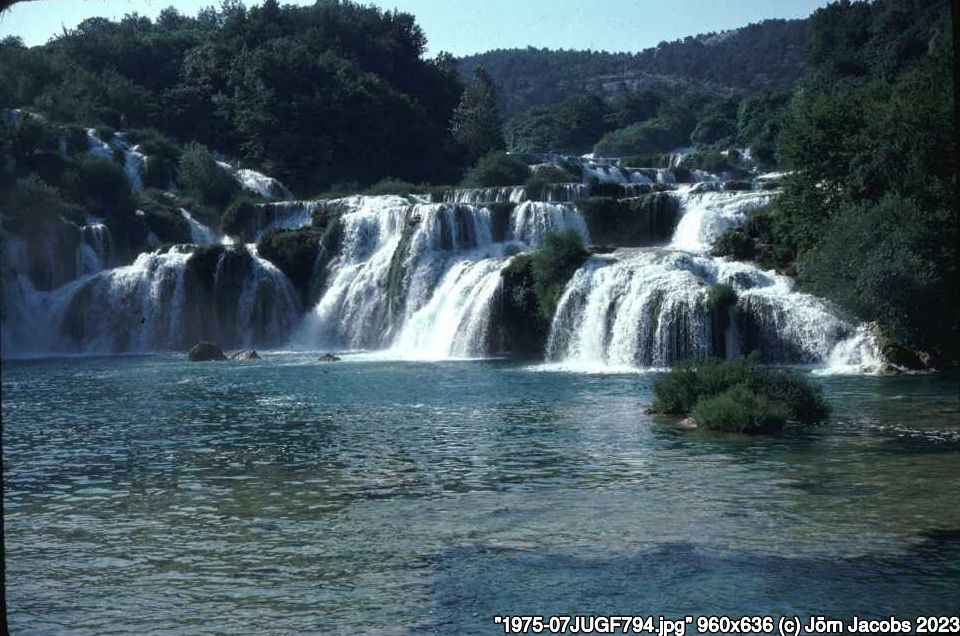 Krka-Wasserfälle, Jugoslawien 1975
Krka-Wasserfälle, Jugoslawien 1975
 Bild 237 und Bild 238: Niagara Falls, 2010
Bild 237 und Bild 238: Niagara Falls, 2010



 Bild 239: Einer der mud pools von Rotorua, New Zealand, gefüllt mit heissem, blubberndem, vulkanischen Matsch. Aug. 2002.
Bild 239: Einer der mud pools von Rotorua, New Zealand, gefüllt mit heissem, blubberndem, vulkanischen Matsch. Aug. 2002.
 Bild 240
Bild 240

 Bild 241: Schon mal irgendwo gesehen? ....Richtig! Das Titelblatt !: Der Neckar bei Edingen/Baden
Bild 241: Schon mal irgendwo gesehen? ....Richtig! Das Titelblatt !: Der Neckar bei Edingen/Baden


* Herzchenbilder
Im Kapitel "Alte Objektive" wurde es schon erwähnt: Spitzlichter können in
Formen gebracht werden. Sie nehmen die Form der Iris-Blende an, japanisch
als "bokeh" (sic) bezeichnet, wenn sie im extremen Unschärfebereich
der Szene liegen.
Hier folgen weitere Beispiele.
Bild 242, Bild 243, Bild 244, Bild 245, Bild 246, Bild 247, Bild 248





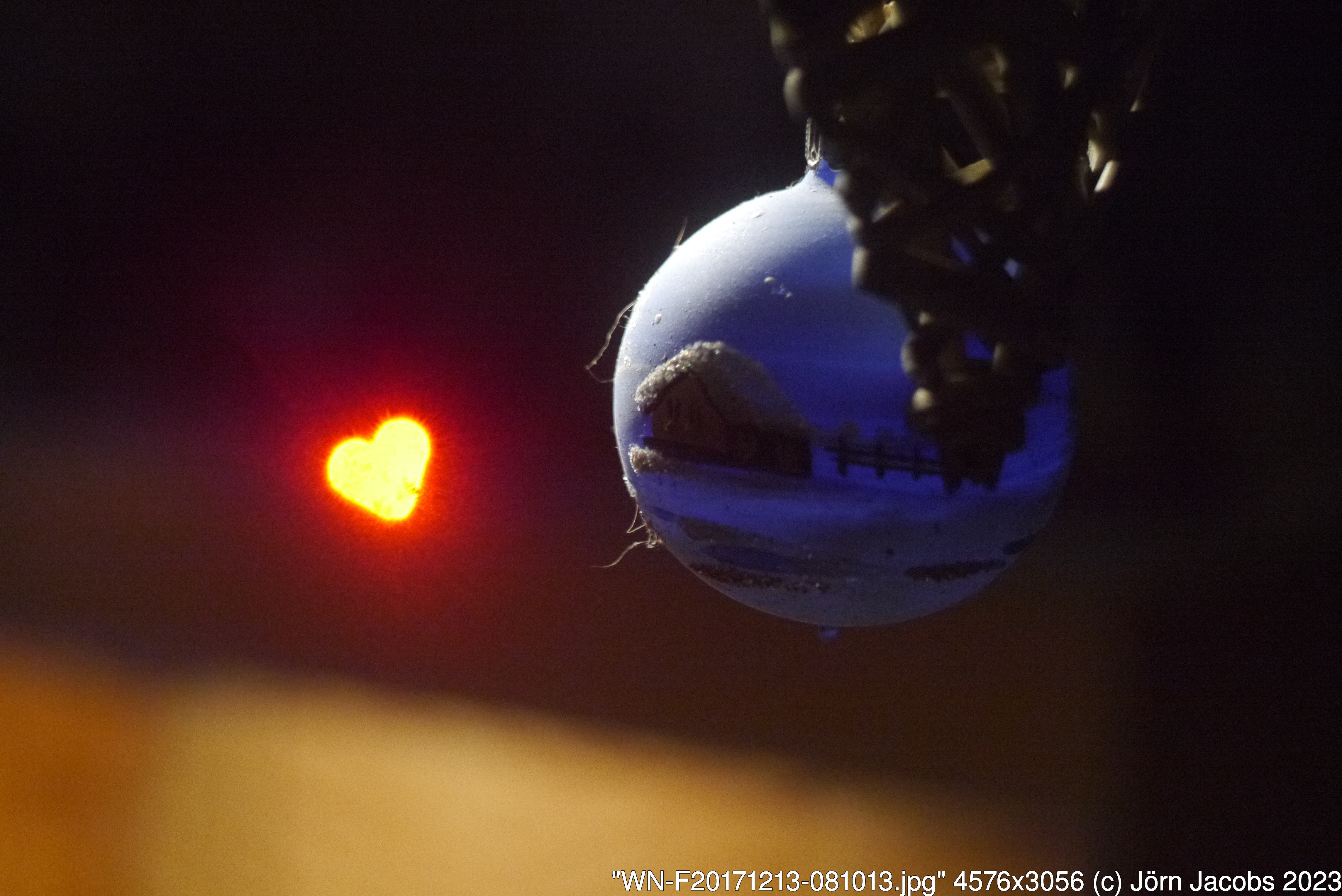


Himmelszeich(nung)en
Bild 249
 Den ""
irdischen" Bereich habe ich etwas aufgehellt,da dieser Teil unterbelichtet war. Aber man kann an einer gemachten Aufnahme in so einem Fall nicht so sehr viel ändern.
Den ""
irdischen" Bereich habe ich etwas aufgehellt,da dieser Teil unterbelichtet war. Aber man kann an einer gemachten Aufnahme in so einem Fall nicht so sehr viel ändern.
 Bild 250: 18.11.2020: Was ist los im Grenzhöfer-/ Friedrichsfelder Wald?
Bild 250: 18.11.2020: Was ist los im Grenzhöfer-/ Friedrichsfelder Wald?

 Bild 251: 01.08.2018: Doppelter Regenbogen über Edingen.
Bild 251: 01.08.2018: Doppelter Regenbogen über Edingen.

 Bild 252: 22.03.2019, 08:54 Uhr: Kondens-Streifen über Edingen. Sie geben einen Eindruck
von der
Dichte des Flugverkehrs. Glücklicherweise sind das alles "Überflieger", die man
wegen der grossen Höhe = Entfernung von meist mehr als 7000 m im "Ländle" nicht
mehr hören kann.
Bild 252: 22.03.2019, 08:54 Uhr: Kondens-Streifen über Edingen. Sie geben einen Eindruck
von der
Dichte des Flugverkehrs. Glücklicherweise sind das alles "Überflieger", die man
wegen der grossen Höhe = Entfernung von meist mehr als 7000 m im "Ländle" nicht
mehr hören kann.

 Bild 253: Sonnenstrahlen bilden einen Trichter
Bild 253: Sonnenstrahlen bilden einen Trichter
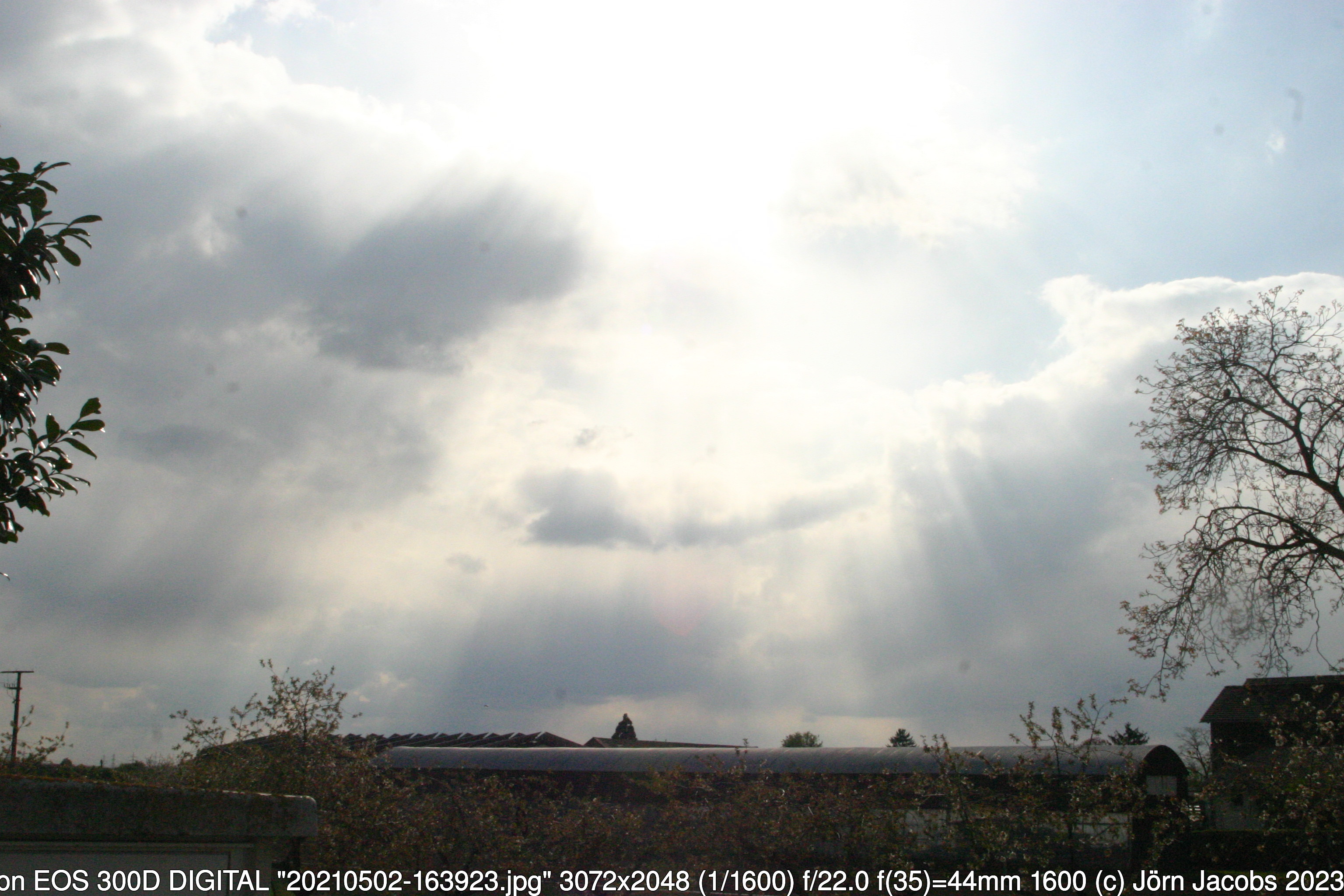
 Bild 254 Sonnenuntergang in Edingen,
Bild 254 Sonnenuntergang in Edingen,

 Bild 255: Wolken, vom Sonnenuntergang erhellt
Bild 255: Wolken, vom Sonnenuntergang erhellt


 Bild 256: Himmelszeichen: Wer ist gemeint?
Bild 256: Himmelszeichen: Wer ist gemeint?
 Bild 257: Was ist da los?
Bild 257: Was ist da los?

 ""Sonnen-Laterne", eigentlich ein Schattenspender...
""Sonnen-Laterne", eigentlich ein Schattenspender...

 Bild 259 Wolkenloch über Mannheim- Neckarstadt
Bild 259 Wolkenloch über Mannheim- Neckarstadt

 Bild 260 Drohende Bewölkung über Edingen
Bild 260 Drohende Bewölkung über Edingen


Silhouettes, Skylines, Weichbilder
Bild 261
 Frankfurt 11.2008: Vom 16. Stock aus der Blick von Sachsenhausen in Richtung Taunus, und
Bild 262
Frankfurt 11.2008: Vom 16. Stock aus der Blick von Sachsenhausen in Richtung Taunus, und
Bild 262
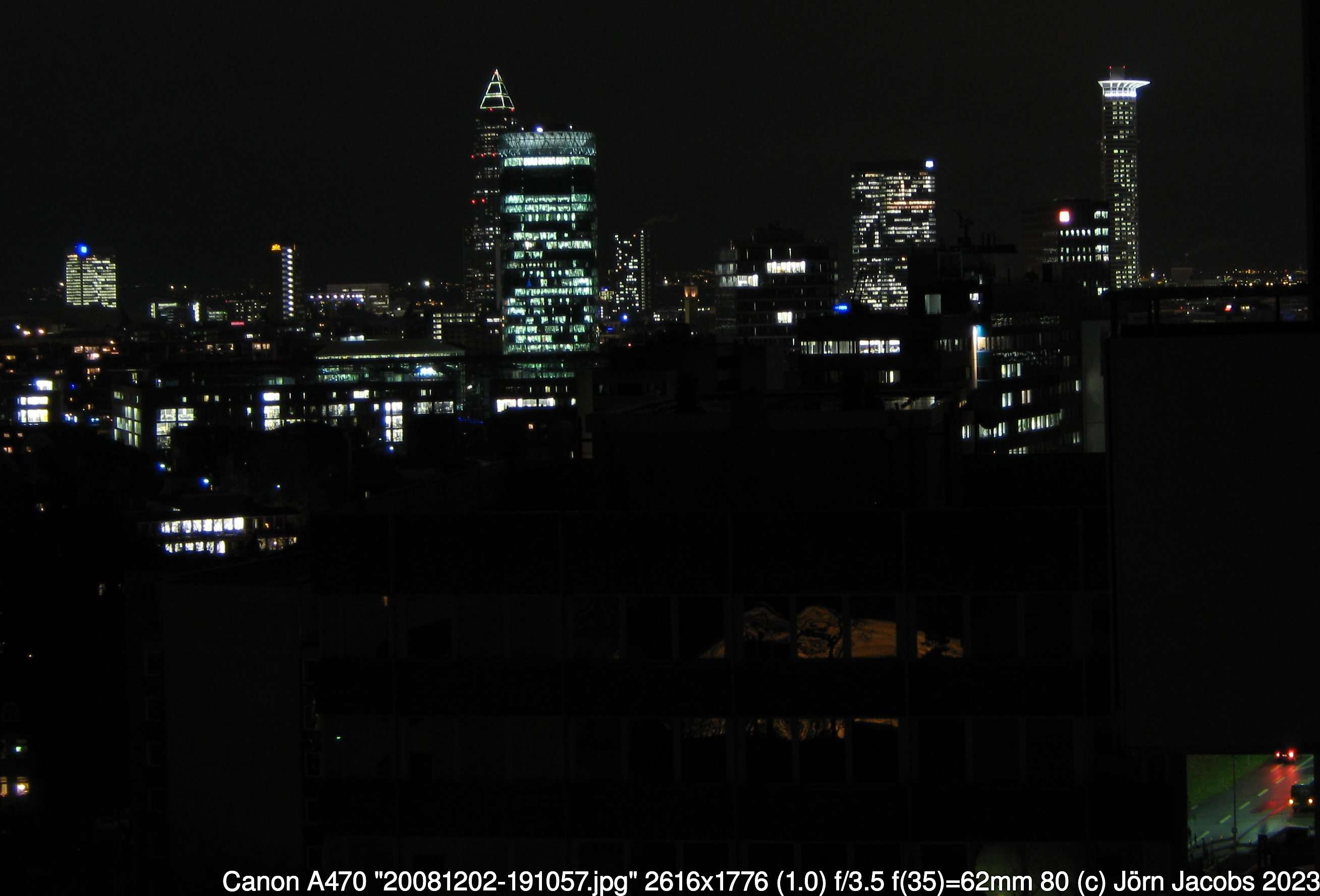 Frankfurt 12.2008: Derselbe Blick bei Nacht (Sachsenhausen -> Taunus)
Frankfurt 12.2008: Derselbe Blick bei Nacht (Sachsenhausen -> Taunus)

* Landschaftsaufnahmen (Fotos von Natur- und Kulturlandschaften)
Ich möchte hier mit einer Ziel-Behauptung beginnen: Landschaftsaufnahmen sollten
malerisch wie ein ""Gemälde" sein. Eine Landschaftsaufnahme soll zunächst einmal natürlich
eine bestimmte Landschaft charakterisieren (das Charakteristische an ihr darstellen),
aber darüber hinaus auch
Vorstellungen, wie: Ruhe, oder auch Bedrohung, Triumph (z.B. der Technik, der Naturgewalten),
usw., für den Betrachter mitschwingen lassen. Momentanes und Mikrodetailliertes
ist dafür irrelevant.
So ein Ziel wird in idealer Weise nur durch ein Gemälde
erreicht:
Bild 263 ist ein Gemälde über die
 Bergstrasse von August Lucas, ca.1845. HLM Darmstadt.
Wir sehen uns das Bild mal mit dem Blick eines Hobbyfotografen an:
Bergstrasse von August Lucas, ca.1845. HLM Darmstadt.
Wir sehen uns das Bild mal mit dem Blick eines Hobbyfotografen an:
Es hat eine deutliche Umrahmung. Lichteinfall und Farben deuten auf Abend hin. Somit ist es ein Blick nach Süden, wo weitere Berge folgen.
Die abgebildeten Menschen stehe nicht im Vordergrund, sind aber mehr als ein Beiwerk.
Wie ist es (vermutlich) entstanden?
- ""Belichtungszeit" misst sich in Tagen,
- Bearbeitungszeit ist Tage bis viele Wochen
- Nachbearbeitung ist sehr umfangreich, auch retouche ist möglich.
- Tiefenschärfeprobleme gibt es nicht, da der Maler die Überlagerung
verschiedener Bildelemente (intuitiv oder auch bewusst) beherrscht.
Eine dem Gemälde überhaupt nur irgendwie näherkommende fotografische Aufnahme wird nur ausnahmsweise
mal spontan gelingen. Eher schon durch Planung:
*Man sieht ein Landschafts-Motiv, und beschliesst, es gelegentlich zu
fotografieren. Anders als viele andere Motive läuft es ja nicht weg!
Man versucht, folgende Punkte zu berücksichtigen:
*Jahreszeit (Vegetation, Sonnenstand),
*Tageszeit,
*Wetter (besonders auch die Wolkenformation),
*Aussichtspunkt" und endgültige Auswahl
*Bildausschnitt (und passendes Objektiv)
Alle Landschaftsaufnahmen werden sich m.E. an
Bildern wie dem Gemälde von August Lucas oder entsprechenden anderen messen lassen müssen.

Das folgende kommt dem irgendwie nah:
Bild 264: Winterabend in Slowenien, 2006.


Bild 265 Paraglide-Flieger über Heidelberg, 2021



Landschaftsähnliches:
Als Kind sah ich bei einem Freund, dessen Vater lange zur See fuhr, ein Ölgemälde
"Wellen im Ozean",
einer Momentaufnahme des bewegten Wassers mit der Illusion einer Landschaft.
Seitdem versuche ich gelegentlich, solches als Fotografie zu realisieren.
 Bild 267, Bild 268: Grenå 2015
Bild 267, Bild 268: Grenå 2015

 Sturm an der jütländischen Ostküste, Sept. 2015.
Sturm an der jütländischen Ostküste, Sept. 2015.
 Bild 269: Wolkenlandschaft: Täuschend ruhig, aber in Wirklichkeit voller Bewegung. Blick aus dem Flugzeugfenster, erstmals gesehen und fotografiert irgendwo zwischen Frankfurt/M und Wien, 1975.
Bild 269: Wolkenlandschaft: Täuschend ruhig, aber in Wirklichkeit voller Bewegung. Blick aus dem Flugzeugfenster, erstmals gesehen und fotografiert irgendwo zwischen Frankfurt/M und Wien, 1975.


Bild 270: Rheintal bei Heidelberg (Grenzhof), 2019. Enorme Tiefenwirkung durch die Aufreihung der Masten. Imposant, aber auch etwas bedrohlich.


Bild 270A: Rheintal bei Heidelberg ,2021. dieselbe Aufreihung der Masten, aber vom Ende aus in Gegenrichtung, und bei Nebel.
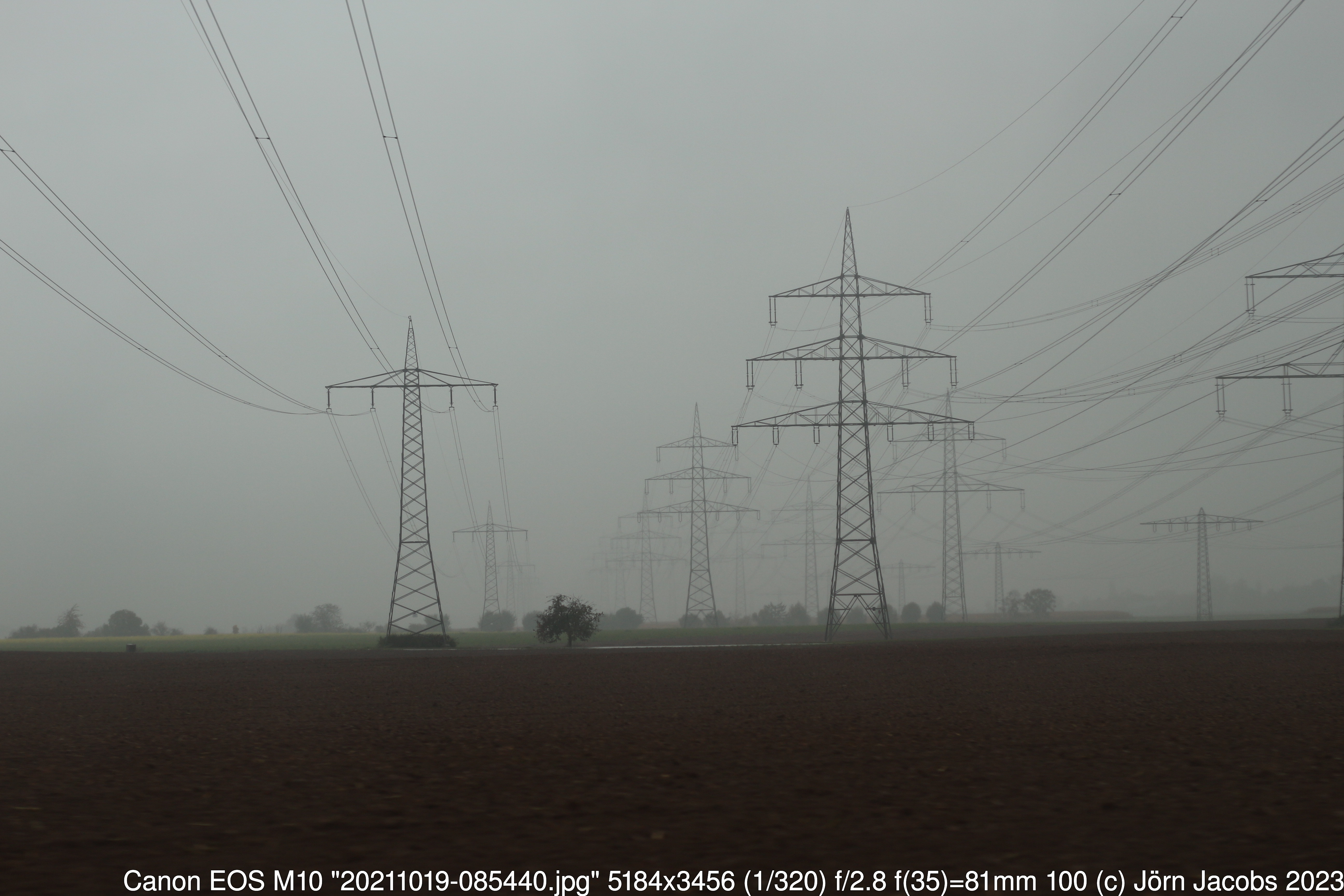


 Diese Aufnahme ist mit einer "Handy"-Kamera gelungen: Das Rheintal bei Edingen, 2016. Die starke räumliche Wirkung der Baumreihe und die
günstigen Lichtverhältnisse mit halbem, abgeschirmten
Gegenlicht lassen kaum etwas vermissen.
Das Bild war lange Zeit mein "Bildschirmschoner".
Diese Aufnahme ist mit einer "Handy"-Kamera gelungen: Das Rheintal bei Edingen, 2016. Die starke räumliche Wirkung der Baumreihe und die
günstigen Lichtverhältnisse mit halbem, abgeschirmten
Gegenlicht lassen kaum etwas vermissen.
Das Bild war lange Zeit mein "Bildschirmschoner".
 <
<
Schreckliche Sachen
Bild 272:
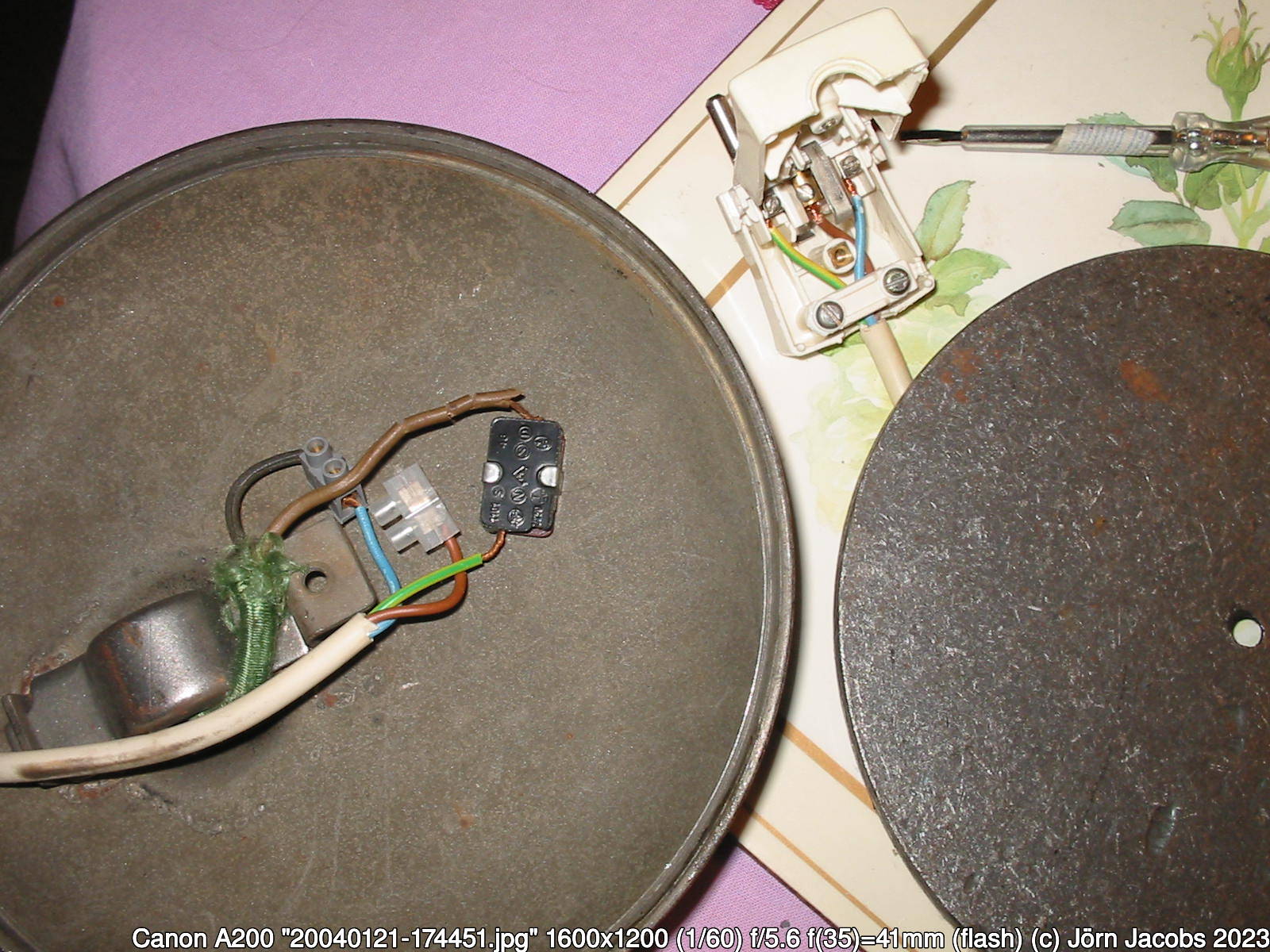 as late as 2004: Eine völlig falsch angeschlossene Tischlampe. Das musste ich als E-Techniker dann doch fotografieren!
as late as 2004: Eine völlig falsch angeschlossene Tischlampe. Das musste ich als E-Techniker dann doch fotografieren!


Rätselhafte Situationen
Bild 273
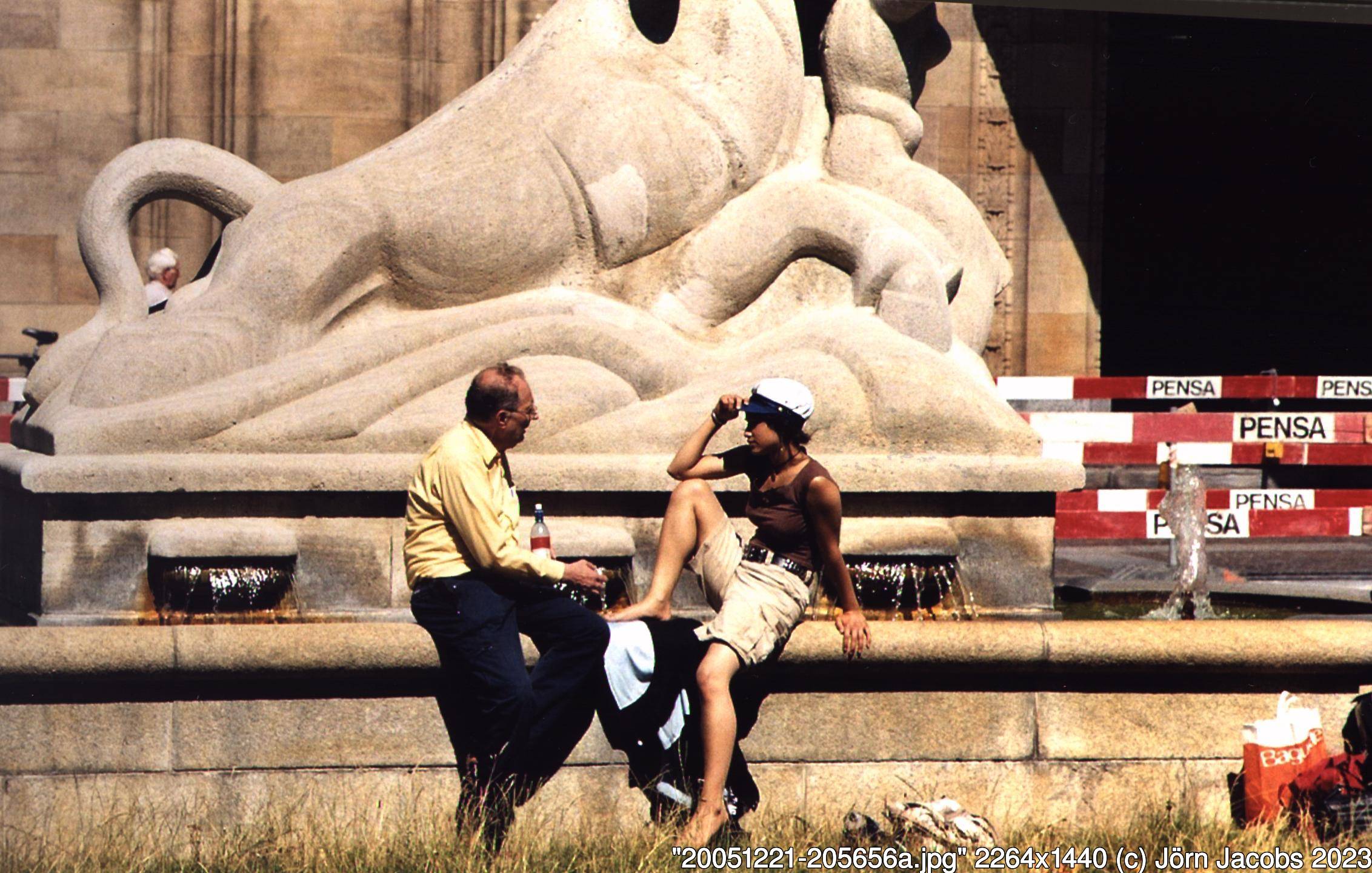 Im Vorbeifahren aus dem Reisebus am Hauptbahnhof von Zürich geknipst. Über
dieses Bild kann man stundenlang nachdenken (Aufforderung
"pensa!"), und wird doch nie
herausfinden können, welche Situation hier vorlag. Dezember 2005.
Im Vorbeifahren aus dem Reisebus am Hauptbahnhof von Zürich geknipst. Über
dieses Bild kann man stundenlang nachdenken (Aufforderung
"pensa!"), und wird doch nie
herausfinden können, welche Situation hier vorlag. Dezember 2005.
Bild 274
 Dubai, 11.2008, Baustelle am Strand bei Hotel Jumeirah. Kamera auf
einen Stein gepresst, und Auslöser gedrückt. .ISO 100, 1 s, f/3.2
Dubai, 11.2008, Baustelle am Strand bei Hotel Jumeirah. Kamera auf
einen Stein gepresst, und Auslöser gedrückt. .ISO 100, 1 s, f/3.2
Situationskomisches
Bild 275
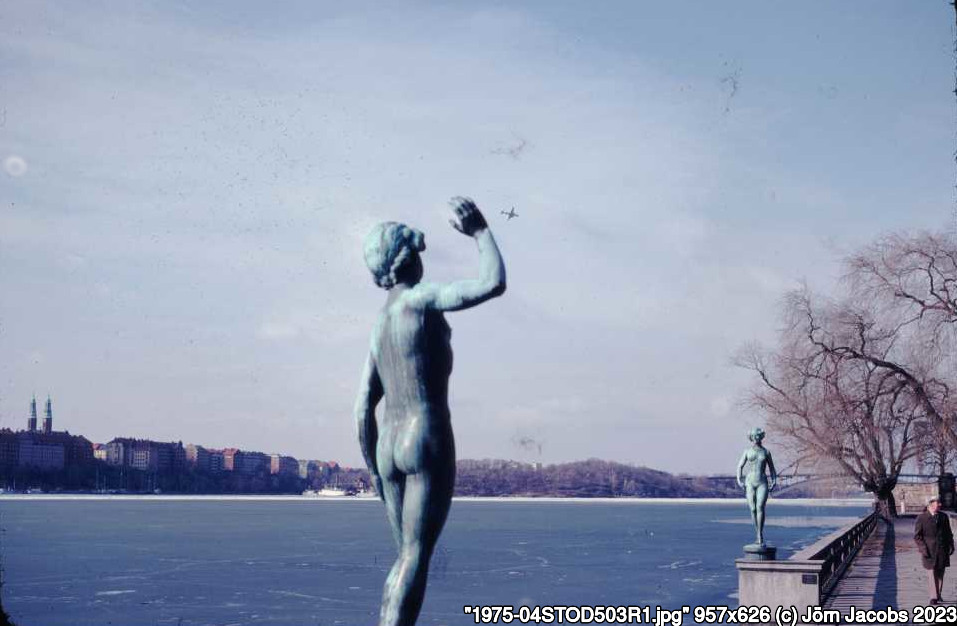 Nixe wirft Flugzeug (Stockholm, 1975)
Nixe wirft Flugzeug (Stockholm, 1975)
 Bild 276
Bild 276
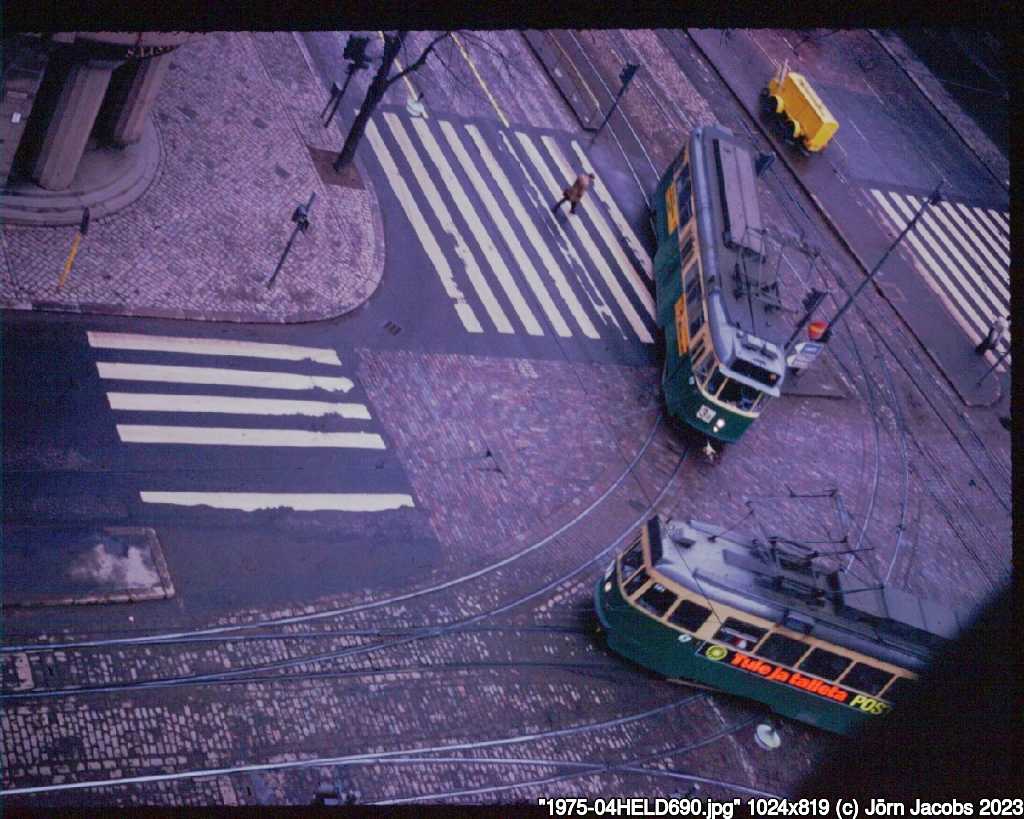 Wer hat Vorfahrt? Helsinki, April 1974.
Wer hat Vorfahrt? Helsinki, April 1974.

 Die Ahr hat Hochwasser, Sept. 2007.
Bild 278
Die Ahr hat Hochwasser, Sept. 2007.
Bild 278



Bild 280 Schmelzender Schneehut kurz vor dem Abrutschen. Darmstadt, Jan. 2010


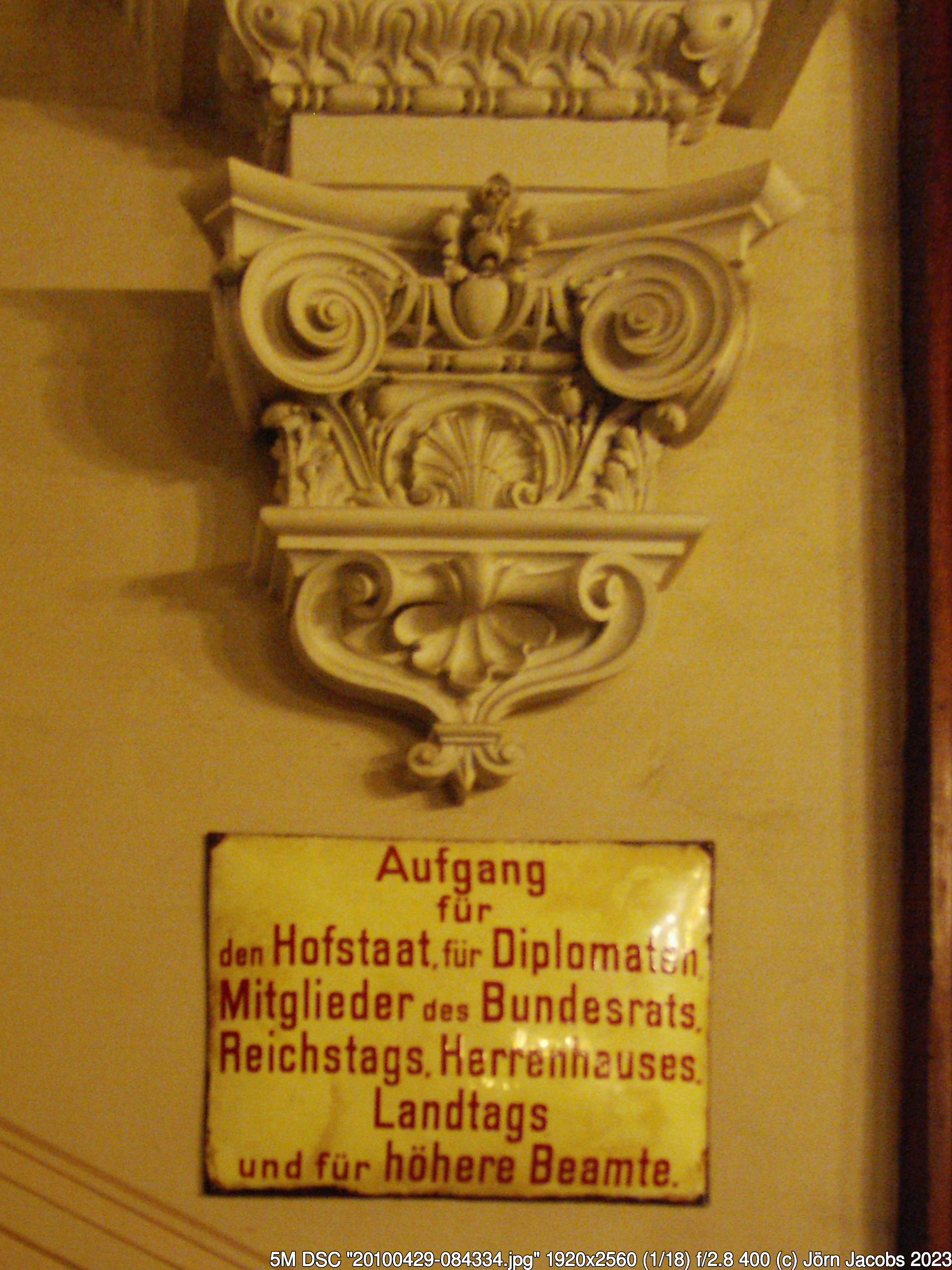 Bild 283: Altes Schild im Berliner Dom.
Bild 283: Altes Schild im Berliner Dom.


Humor & Skuril : Hier klickert es!


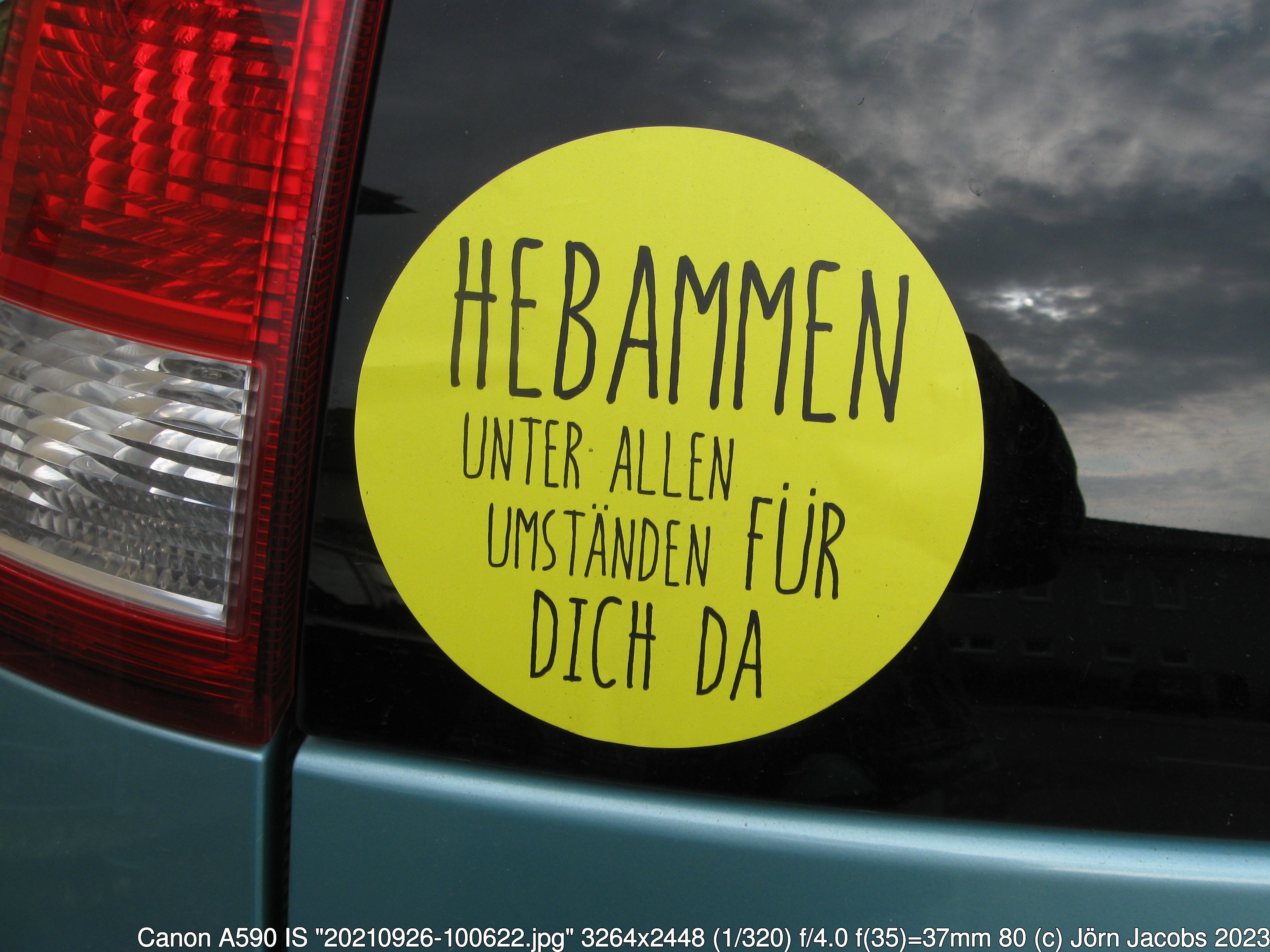


Spiegel-Spiele: Ein wenig Selbstbildnis ist hier fast immer dabei...
 Bild 313
Bild 313
 Bild 314
Bild 314
 Bild 315
Bild 315
 Bild 316
Bild 316
 Bild 317
Bild 317
 Bild 318
Bild 318
 Bild 319
Bild 319
 Bild 320
Bild 320
 Bild 321
Bild 321
 Bild 322
Bild 322
 Bild 323
Bild 323
 Bild 324
Bild 324
 Bild 325
Bild 325
 Bild 326
Bild 326


 Bild 362A
Bild 362A
 Eine fast perfekte Verdoppelung gelang hier durch Spiegelung an einer Trennscheibe zwischen WC und Dusche
Eine fast perfekte Verdoppelung gelang hier durch Spiegelung an einer Trennscheibe zwischen WC und Dusche


(un-)gewöhnliche Bildverzerrungen
Kann man z.B. mit einer silber-oder goldfarbenen, spiegelnden Weihnachtskugel erzeugen,
Bild 463. Typischer Nebeneffekt dabei: Kamera und Fotograf sind immer mit auf dem Bild!



Ein kurzer Blick in das Unendliche
Bild 328
 Viele Badezimmer haben einen Spiegel mit seitlich klappbaren Flügeln. Bei
geschickter Einstellung kann man den Blick viele Male hin- und zurückreflektieren:
Man sieht sich und die Kamera vielfach entlang des "Ganges"
(Nicht der Fluss in Indien!). Digitalkameras sind gut dafür geeignet, denn man
kann bei langsamer Bewegung der Seitenteile ganz viele Aufnahmen machen, und
dann später die nicht so guten löschen. Und: Gegebenenfalls das Lächeln nicht
vergessen!
Viele Badezimmer haben einen Spiegel mit seitlich klappbaren Flügeln. Bei
geschickter Einstellung kann man den Blick viele Male hin- und zurückreflektieren:
Man sieht sich und die Kamera vielfach entlang des "Ganges"
(Nicht der Fluss in Indien!). Digitalkameras sind gut dafür geeignet, denn man
kann bei langsamer Bewegung der Seitenteile ganz viele Aufnahmen machen, und
dann später die nicht so guten löschen. Und: Gegebenenfalls das Lächeln nicht
vergessen!
 Bild 329
Bild 329
 Ein ähnliches Spiel lässt sich machen, wenn man das Videosignal einer
Kamera auf einem Monitor leitet, und dann die Kamera auf das
Monitorbild richtet: Blick ins elektronische Unendlich.
Ein ähnliches Spiel lässt sich machen, wenn man das Videosignal einer
Kamera auf einem Monitor leitet, und dann die Kamera auf das
Monitorbild richtet: Blick ins elektronische Unendlich.

Grosse spiegelnde Flächen
 Bild 331
Bild 331
 Århus, 2018
Århus, 2018
 Bild 332
Bild 332
 Darmstadt 2008: Spiegelung des Alten Theaters (alias "Hessisches Staatsarchiv") im ""neuen", tatsächlich so schrägwandig gebauten TU-Portal.
Darmstadt 2008: Spiegelung des Alten Theaters (alias "Hessisches Staatsarchiv") im ""neuen", tatsächlich so schrägwandig gebauten TU-Portal.
 Bild 333
Bild 333
 Washington, D.C. Airport, 2006. Ob der Fussboden heut wohl noch so blank ist?
Washington, D.C. Airport, 2006. Ob der Fussboden heut wohl noch so blank ist?
 Bild 334
Bild 334

 Luzern, Winter 2008
Luzern, Winter 2008
 Edingen, 2019: Nach einem Wolkenbruch...
Edingen, 2019: Nach einem Wolkenbruch...
Bild 335

 Bild 336
Bild 336
 Studie zu einer kombinierten Weihnachts-Oster-Karte.
Studie zu einer kombinierten Weihnachts-Oster-Karte.
 Bild 337
Bild 337
 Esszimmer am Nachmittag (mit fisheye-Objektiv). Spiegelung durch eine Plastik-Tischdecke.
Esszimmer am Nachmittag (mit fisheye-Objektiv). Spiegelung durch eine Plastik-Tischdecke.
 Bild 338 Lichterschau im Luisenpark, Mannheim, März 2020. Unerwartet schön ist auch die
Reflex-Wirkung auf dem feuchten Boden im zweiten Bild. Man könnte dieses Bild natürlich auch noch entzerren/begradigen. Dann sieht es aber deutlich langweiliger aus.
Bild 338 Lichterschau im Luisenpark, Mannheim, März 2020. Unerwartet schön ist auch die
Reflex-Wirkung auf dem feuchten Boden im zweiten Bild. Man könnte dieses Bild natürlich auch noch entzerren/begradigen. Dann sieht es aber deutlich langweiliger aus.

 Bild 339
Bild 339

 Bild 340
Bild 340
 In Memoriam Joy Fleming: Plakat mit einer Spiegelung des Edinger Rathauses, Dez. 2015
In Memoriam Joy Fleming: Plakat mit einer Spiegelung des Edinger Rathauses, Dez. 2015

 Bild 342
Bild 342
 Künstlicher Weihnachtsmann auf verregnetem Weihnachtsmarkt, Darmstadt 2009.
Künstlicher Weihnachtsmann auf verregnetem Weihnachtsmarkt, Darmstadt 2009.
 Bild 343
Bild 343
 Diese spiegelnde Fläche ergab sich unerwartet: Ich wollte nur das Abendrot am Ende der Strasse einfangen, und hatte dazu die immer-dabei-Kamera (IXUS 60) auf das recht hohe, noch feuchte Autodach gestellt.
Diese spiegelnde Fläche ergab sich unerwartet: Ich wollte nur das Abendrot am Ende der Strasse einfangen, und hatte dazu die immer-dabei-Kamera (IXUS 60) auf das recht hohe, noch feuchte Autodach gestellt.
 Bild 343A
Bild 343A
 Das Autodach des Mietwagens war pieksauber, leicht gewölbt und nicht zu hoch, und lud so zu einer kleinen Verfremdung ein. Bryce Canyon, 2004
Das Autodach des Mietwagens war pieksauber, leicht gewölbt und nicht zu hoch, und lud so zu einer kleinen Verfremdung ein. Bryce Canyon, 2004

Stilleben (klass.)
Bild 344

Stilleben (verfremdet)
Bild 345
 Bild 346
Bild 346
 Lag wochenlang im Gras-,
Lag wochenlang im Gras-,
was soll das-?
Edingen,Feb. 2017


Tiere und Haustiere: Galerie der Tier-Antlitze
T I E R E : click here!



unusual views:

durch die Aufnahmetechnik verfremdet
Bild 465
 Weibliche Formen, vervielfacht durch ein spezielles Prismenfilter
(wird sonst bei Videoaufnahmen für Überblendungen benutzt)
Weibliche Formen, vervielfacht durch ein spezielles Prismenfilter
(wird sonst bei Videoaufnahmen für Überblendungen benutzt)
 Bild 466
Bild 466
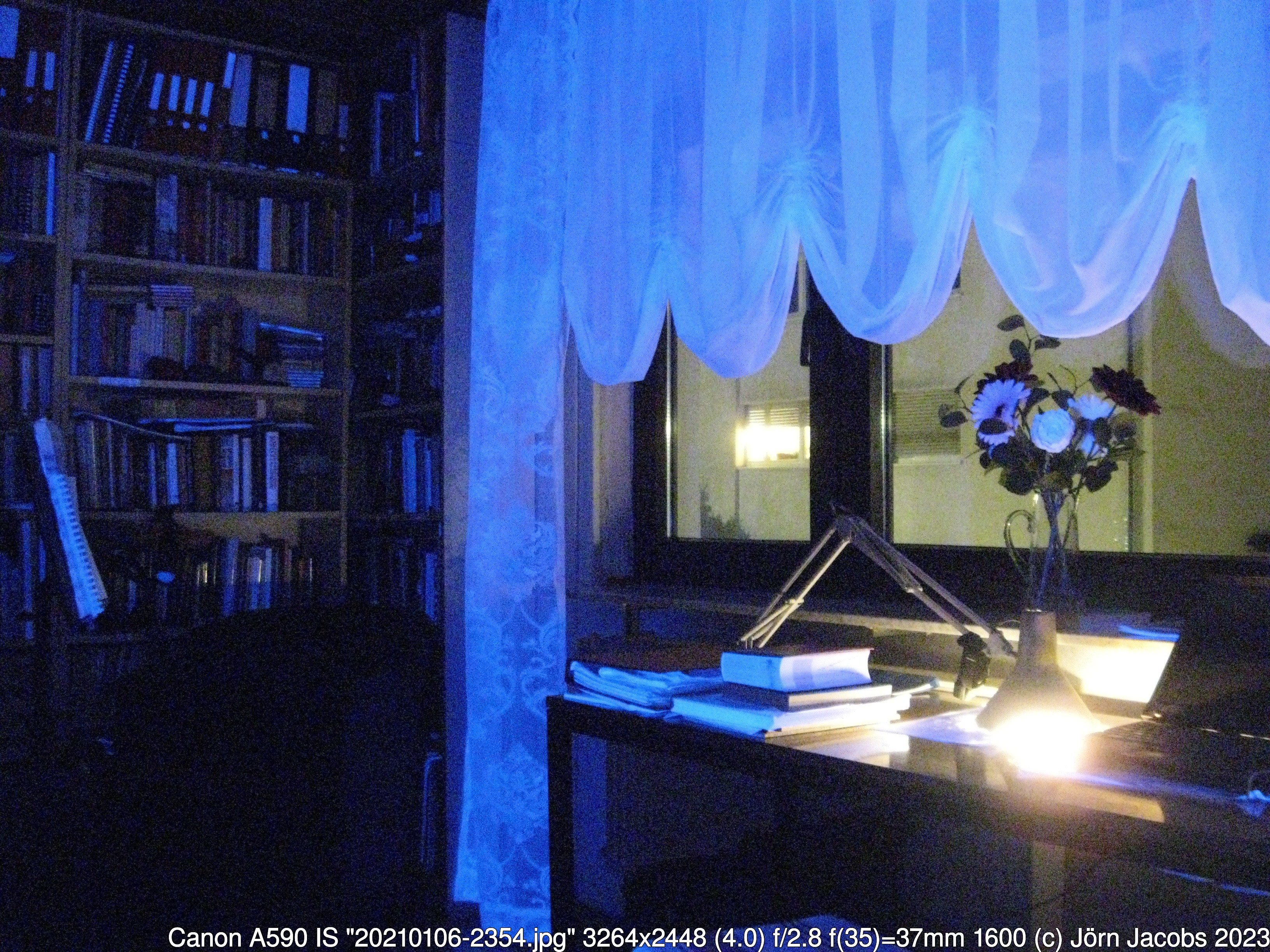 Unten: In einem
dunklen Zimmer regt eine Blaulichtlampe bestimmte Substanzen zum
Leuchten an, z.B. die Aufheller in den Gardinen.
Unten: In einem
dunklen Zimmer regt eine Blaulichtlampe bestimmte Substanzen zum
Leuchten an, z.B. die Aufheller in den Gardinen.

Bild 467
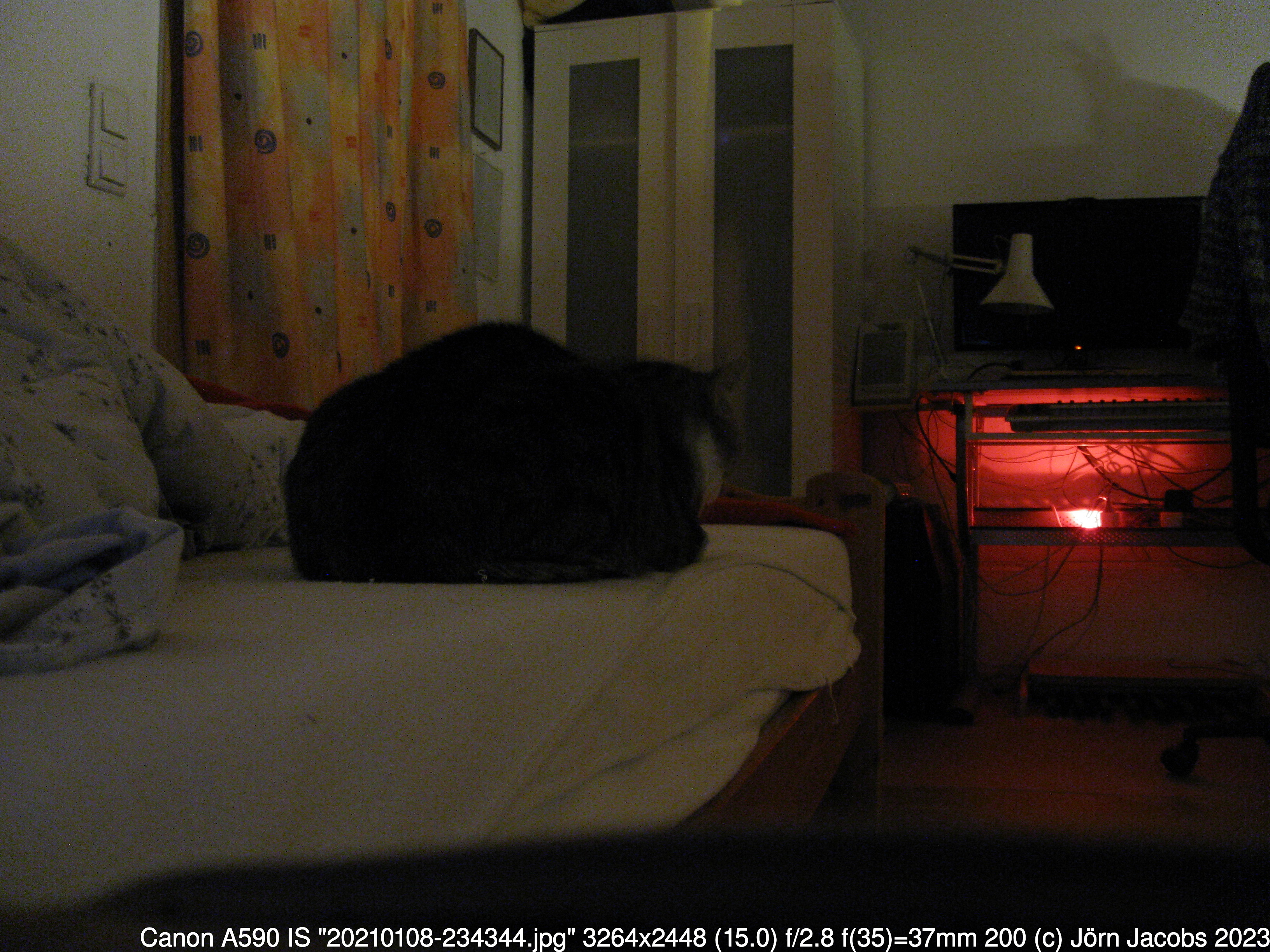 Langzeitbelichtung mit 1 Minute; das Zimmer ist nur spärlich beleuchtet,
eine rote Kontrolleuchte dominiert nun. Die Katze hat sich nicht bewegt,
sie erschiene sonst nur schemenhaft oder wäre unsichtbar.
Langzeitbelichtung mit 1 Minute; das Zimmer ist nur spärlich beleuchtet,
eine rote Kontrolleuchte dominiert nun. Die Katze hat sich nicht bewegt,
sie erschiene sonst nur schemenhaft oder wäre unsichtbar.
Feuerwerksaufnahmen gelingen als Langzeitaufnahmen fast immer,
wenn man ein Stativ benutzt und die Kamera im Av-Modus durch Wahl
von ISO-Empfindlichkeit und Blendenwert dazu bewegen kann, den
Verschluss etwa 1 s (abdrücken, wenn die Rakete hochzischt) bis
zu vielleicht 10 s (mehrere Feuerwerkskörper überlagern sich)
offenzuhalten. Feuerwerk auf der Neckarbrücke anlässlich der
Heidelberger Schlossbeleuchtung. Kamera Lumix G3 im Av-Modus,
mit manuellem Tele, F/?, ISO 3200 ergab 1/2 s Belichtungszeit.

Bild 468

 Wie aber gestaltet man eine Sylvester-Feuerwerksaufnahme, wenn die
""Anzahl der "Knaller" eher gering ist, wie hier in enem eher ruhigen Edinger Wohngebiet? Kamera auf Stativ, chdk-Bewegungserkennung macht über die Zeit dann mehrere Aufnahmen ("was halt so kommt"). Die schönsten werden später herausgesucht, etwas kontrastverstärkt (um das Rauschen in den dunklen Bildpartien zu mildern), dann alle schwarzen Flächen durch Tranzparenz ersetzt, und die Bilder
mit Bildverarbeitung überlagert. Voilà!
Wie aber gestaltet man eine Sylvester-Feuerwerksaufnahme, wenn die
""Anzahl der "Knaller" eher gering ist, wie hier in enem eher ruhigen Edinger Wohngebiet? Kamera auf Stativ, chdk-Bewegungserkennung macht über die Zeit dann mehrere Aufnahmen ("was halt so kommt"). Die schönsten werden später herausgesucht, etwas kontrastverstärkt (um das Rauschen in den dunklen Bildpartien zu mildern), dann alle schwarzen Flächen durch Tranzparenz ersetzt, und die Bilder
mit Bildverarbeitung überlagert. Voilà!
 Bild 469
Bild 469


Bild 470 Spitzlichter bekommen durch das Filter rechts einen Stern.
 Bild 471
Bild 471

Kunstwasserfall im Heidelberger Zoo: Linkes Bild mit langer Belichtungszeit aufgenommen
(1/2 s, Blende F/25), rechtes Bild mit kurzer Belichtungszeit (1/60 s, Blende F/4.0).
Bild 472
 />
Bild 473
/>
Bild 473

 Bild 474
Bild 474
 Backen blasen Pusteblume: Kamera Canon PowerShot SX230 HS, 1/250 s, F/5.9, ISO 125 />
Brennweite 70 mm (Tele,(35 mm equivalent: 390.9 mm)); eine Spontanaufnahme aus
grösserer Entfernung. Da viel Licht da war, konnten dank 1/250 s die wegfliegenden
Samen noch eingefangen werden. Sonst hätte man näher dran sein müssen, und wohl den Blitz benutzen.
Backen blasen Pusteblume: Kamera Canon PowerShot SX230 HS, 1/250 s, F/5.9, ISO 125 />
Brennweite 70 mm (Tele,(35 mm equivalent: 390.9 mm)); eine Spontanaufnahme aus
grösserer Entfernung. Da viel Licht da war, konnten dank 1/250 s die wegfliegenden
Samen noch eingefangen werden. Sonst hätte man näher dran sein müssen, und wohl den Blitz benutzen.

Bilder, anhand der szenischen Umstände passend kombiniert, und dadurch scheinbar unverfremdet:
Bild 475
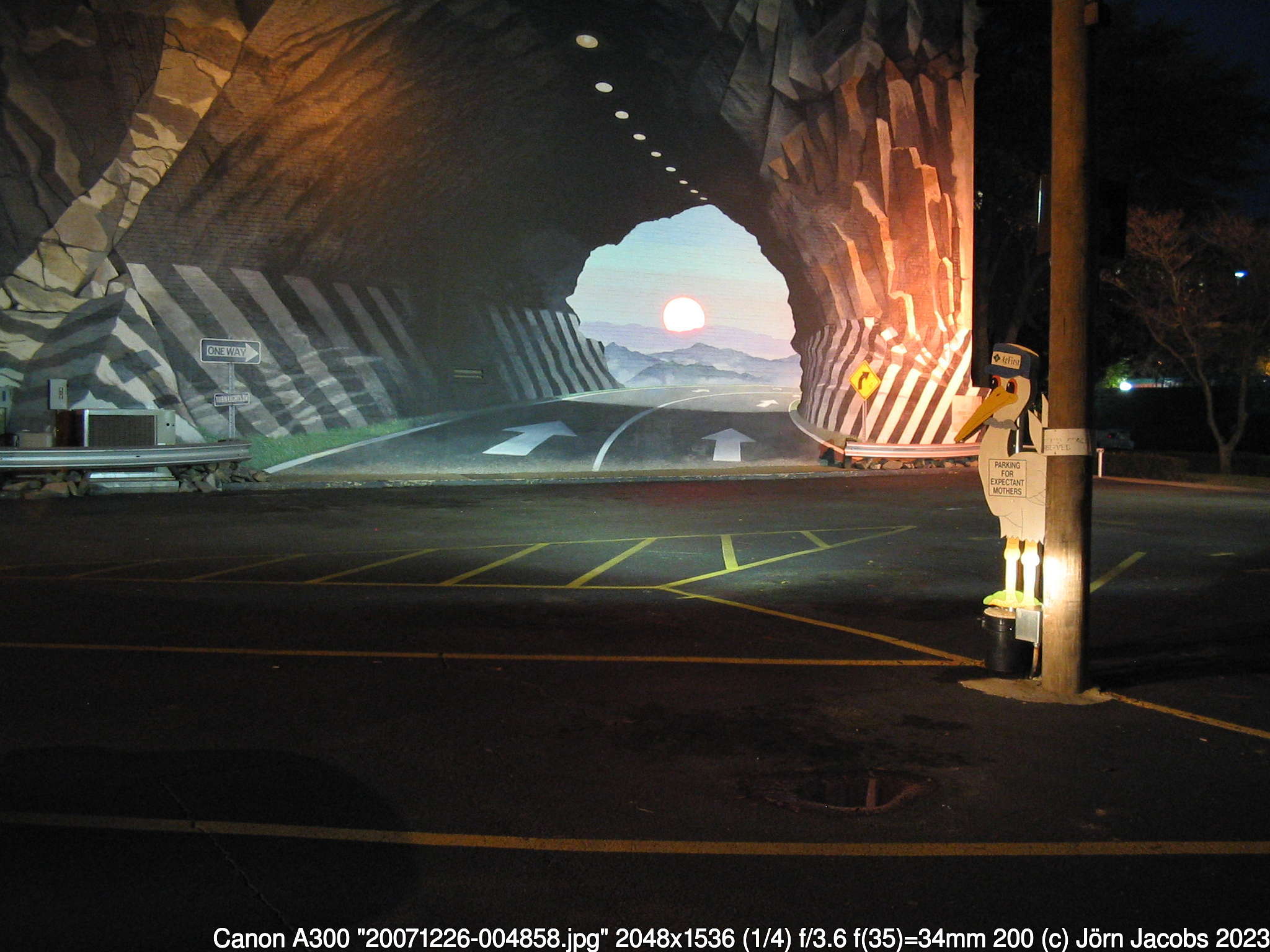 Parkplatz-Erweiterung durch ein Wandgemälde an der Frauenklinik
in
Columbia, S.C., 2007. Der Klapperstorch rechts vorn an der Laterne ist noch im
echten" Bereich, wo auch ich mit der Kamera gestanden habe. Der reale Parkplatz endet
an der gemalten waagerechten Tunneleinfahrtslinie".
Parkplatz-Erweiterung durch ein Wandgemälde an der Frauenklinik
in
Columbia, S.C., 2007. Der Klapperstorch rechts vorn an der Laterne ist noch im
echten" Bereich, wo auch ich mit der Kamera gestanden habe. Der reale Parkplatz endet
an der gemalten waagerechten Tunneleinfahrtslinie".
Bild 476
 Neue Mensa (Cafeteria) der Uni Frankfurt, 1994: Der Saal wurde durch
ein gleichmöbliertes Wandbild mit Promi- und Comic-Publikum optisch
erweitert. Der grosse Tisch vorne im Bild ist noch echt. Ich habe dort
unzählige Male gesessen und gegessen. Dieses Gemälde musste
ich einfach retten! Ob es wohl heute (2021) noch dort zu sehen ist??
Neue Mensa (Cafeteria) der Uni Frankfurt, 1994: Der Saal wurde durch
ein gleichmöbliertes Wandbild mit Promi- und Comic-Publikum optisch
erweitert. Der grosse Tisch vorne im Bild ist noch echt. Ich habe dort
unzählige Male gesessen und gegessen. Dieses Gemälde musste
ich einfach retten! Ob es wohl heute (2021) noch dort zu sehen ist??
durch versteckte Manipulation verfremdet:


 Sonne über der kath. Kirche Edingen, 2015. Durch Verwendung des Filters (Abb. rechts) mit eingeschliffener Rautenstruktur bekam die Sonne, das Spitzenlicht par excellence,
sechs Strahlen.
Bild 479
Sonne über der kath. Kirche Edingen, 2015. Durch Verwendung des Filters (Abb. rechts) mit eingeschliffener Rautenstruktur bekam die Sonne, das Spitzenlicht par excellence,
sechs Strahlen.
Bild 479
 Bild 480
Bild 480


Wenig bekannte Details
Bild 481
 Sich über viele Meter abseilende Raupe im Schlosspark Wolfsgarten, 2005.
Sich über viele Meter abseilende Raupe im Schlosspark Wolfsgarten, 2005.
Bild 482
 <
<

wenn bekanntes unbekannt aussieht:
Bild 484
 Bild 485
Bild 485
 Im Auto links hat sich der Fahrer versteckt, wohl aus Angst vor einer Gardinenpredigt.
Im Auto rechts bereitet sich der Meister dann hochkonzentriert aufs Rollen vor.
Im Auto links hat sich der Fahrer versteckt, wohl aus Angst vor einer Gardinenpredigt.
Im Auto rechts bereitet sich der Meister dann hochkonzentriert aufs Rollen vor.
Normalobjektive
Als Normalobjektv bezeichnet man ein Objektiv, das einen
Bildwinkel von 45 Grad abbildet. Für das alte 6x6cm Filmformat hatte das
Objektiv dann eine Brennweite von 75mm, beim Rollfilm 6x9 cm wären das sogar
105mm. Am bekanntesten sind auch noch heute die Zahlen für den sogenannten
Kleinbildfilm (Kleinbildfilmformat 24x36mm), wo ein Normalobjektiv 50 mm
Brennweite hat. Bei den Digitalkameras sind die Verhältnisse unübersichtlich.
Die kleinen Kompaktkameras haben meist ohnehin keine Wechselobjektive, und die
Photosensoren sind sehr klein. Die Normalbrennweite ist deshalb eher im unteren
mm-Bereich. Bei den Kameras für höhere Qualitätsansprüche sind die Bildsensoren
zwar grösser, unter anderem aus Kosten- /Geschwindigkeits- / Kompatibilitätsgründen
aber dennoch meist noch deutlich kleiner als 24x36mm. Nur die sogenannten Vollformatkameras
haben dieses Mass, und erlauben daher die Verwendung von alten
Objektiven ohne Umgewöhnung.
Objektive siehe Weitwinkel-, Tele-, Normal-, Zoom-, Wechselobjektive
Probeaufnahmen
... waren früher für den Hobby-Fotografen fast ausgeschlossen, da viel zu teuer. Wer zudem schon eine Spiegelreflexkamera sein eigen nannte, vertraute oft dem Sucherbild und den "wohl" richtigen Einstellungen, oder falls vorhanden der "Automatik"; die Enttäuschung über misslungene Aufnahmen folgte daraus ziemlich oft, und hinterliess zudem wohl auch viele wenig benutzte Kameras.
Bei Digitalkameras ist die Situation völlig anders: Probeaufnahmen kosten überhaupt nichts; misslungene Bilder kann man einfach löschen. Dies sollte man allerdings auch recht konsequent tun, damit die Speicherkarte nicht doch zu schnell voll wird.
Und die misslungene Aufnahme sollte man dann einfach nochmals versuchen, mit veränderten Einstellungen. Und immer mehrere Aufnahmen nacheinander machen, um dann später aus den gelungenen die schönste herauszusuchen.
Schwarzweissbilder heute ..
Schwarzweissbilder waren ganz früher die einzig mögliche Art von Fotografie; ab den 1930er Jahren
bis etwa 1970 dann die immer noch kostenmässig gangbarere Variante gegenüber
unerschwinglichen, qualitativ mässigen Farbfotos. Für akzeptablere Farbwiedergabe bei mässigem Preis und Umweg über eine "Umkehranstalt" (siehe
Abschnitt über die Retina IIc) gab es dann die sogenannten Dias. Heute ist S/W bei
Papierbildern fast völlig verschwunden. Es gibt aber noch Leute, die darauf
schwören. In mir meldet sich hier allerdings der Ingenieur zu Wort und weist auf den viel, viel
höheren Informationsgehalt eines Farbbildes hin.
In Publikationen drücken S/W-Aufnahmen heute,
ob echt oder gestellt, die Referenz auf alte Zeiten aus. So auch bei unserer
ältesten Tochter, die sich von mir ein Heidelberg-Bild für ihr Wohnzimmer
gewünscht hatte. Aber es musste unbedingt Schwarzweiss sein! Murrend habe ich mich
dem gebeugt und die Farbaufnahme "entfärbt" und noch etwas kontrastverstärkt.
Hier die beiden Versionen untereinander. Ich finde die farbige Variante trotzdem schöner,
informativer und authentischer. Und: Die Scharzweissversion grossformatig
ausdrucken zu lassen war keineswegs billiger!
Bild 486
 Bild 487
Bild 487

 "Selbstbildnisse"
"Selbstbildnisse"
1 Selbstbildnisse des Hobby-Fotografen machen heute viele mit ihrem "Handy",
which in
fact comes in handy for that purpose, da "immer dabei". Wenn die Qualität etwas
besser sein soll, und die Gesichter nicht so merkwürdig rundlich, ist ansonsten mindestens eine kleine Taschenkamera mit Selbstauslöser ("Timer") und ein
Stativ notwendig. In Innenräumen kann man die Kamera auch oft auf ein
Bücherregal stellen.
Besonders lebendige Aufnahmen gelingen, wenn man mit CHDK und
Bewegungserkennung arbeiten kann; Es ist klar:
die Bewegungserkennung ignoriert das Statische, und
drückt erst bei kleinen (grossen natürlich auch), unabsichtlichen,
und eventuell auch provozierten Bewegungen auf den Auslöser: Die Bilder wirken "lebendiger".
Bild 488
 Bild 489
Bild 489

Oder einfach so...(schon 2003)
Bild 490
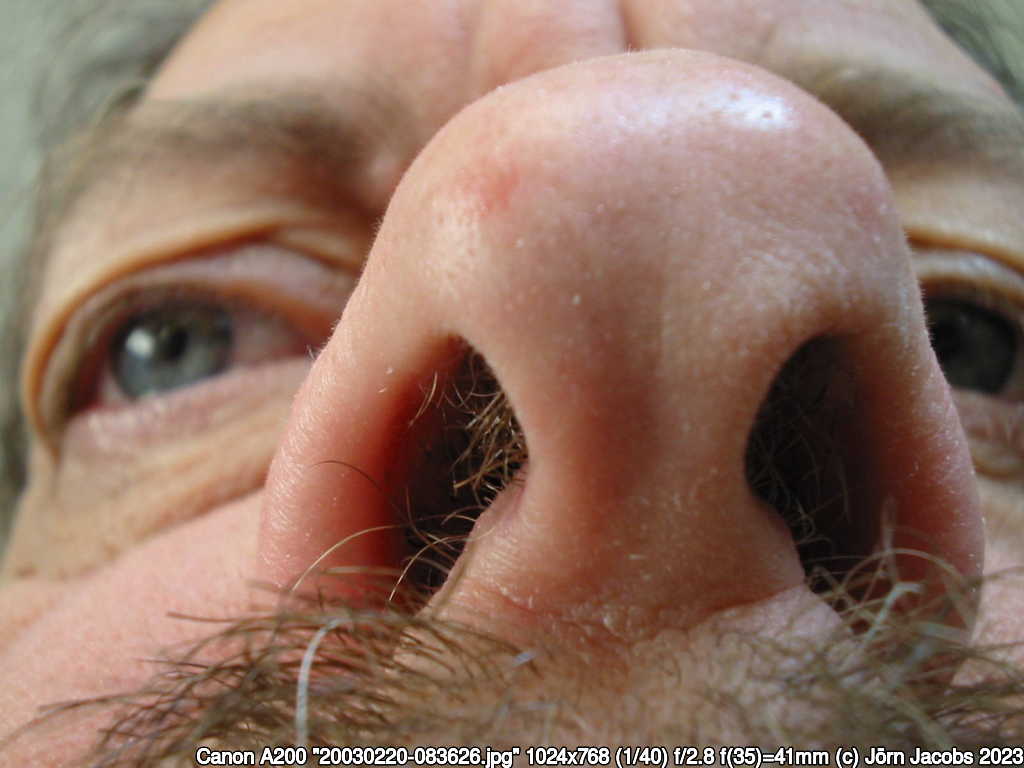

2 Selbstbildnis der Kamera
Bild 491
 kommt selten vor, und man braucht einen Spiegel!
(hier ein (Überwachungs?-)Spiegel in einem Supermarkt,
in dem sich meine Digital IXUS 60 ... spiegelt.
Bild 492
kommt selten vor, und man braucht einen Spiegel!
(hier ein (Überwachungs?-)Spiegel in einem Supermarkt,
in dem sich meine Digital IXUS 60 ... spiegelt.
Bild 492
 Vor dem Wölbspiegel: Eine Canon Powershot G2. Bei allen Spiegel-Aufnahmen und besonders bei Kamera-Selbstbildnissen gilt: Die Aufnahme sollte man, wie hier geschehen, bei der Nachbearbeitung eventuell "spiegeln", damit Beschriftungen lesbar sind.
Vor dem Wölbspiegel: Eine Canon Powershot G2. Bei allen Spiegel-Aufnahmen und besonders bei Kamera-Selbstbildnissen gilt: Die Aufnahme sollte man, wie hier geschehen, bei der Nachbearbeitung eventuell "spiegeln", damit Beschriftungen lesbar sind.

3 Selbstbildnis des für eine Testserie verwendeten Objektivs.
.
Dies ist wichtig, da besonders bei alten, nicht-elektrischen Objektiven die
exif-Einträge in den Bilddateien ja nichts über das verwendete Objektiv
aussagen, und man später eventuell nicht mehr genau weiss, welches Objektiv nun getestet
wurde. Bei Teleobjektiven ist nun ja ein "Selbstbildnis" des Objektivs mit einem
Spiegel praktisch nicht möglich. In einem Internet-Forum (habe
leider vergessen, welches...) habe ich den Tipp gelesen, das zu testende
Objektiv vor dem Test, mit derselben Kamera, allerdings mit einem Weitwinkel-
oder Normalobjektiv, abzufotografieren. Dadurch ist dann immer jeweils das
erste Bild der gespeicherten Serie eindeutig dem Test-Kandidaten zugeordnet.
Speicherkarten
Meine ersten Digitalkameras (Canon Powershot A200, Pro 1 usw.) benutzten
CF (“compact flash“) Karten. Diese haben eine 64(!)-polige Steckverbindung, dafür aber nur wenig Steuerelektronik eingebaut, denn die Datenübertragung geht
im wesentlichen parallel über die vielen (Adress- und Daten-)-Drähte, und mit Adaptern von "CF-auf-PCMCIA" konnte man die Karten direkt auslesen,
denn alle Laptop-Computer hatten damals eine PCMCIA-Schnittstelle.
Auch konnte diese Schnittstelle das enorme Wachstum an Kartenkapazität
(von anfangs 8 Megabytes auf z.b. 64 Gigabytes, immerhin das 8000-fache!)
ohne Änderungen verkraften. Aber mechanisch ist sie aufwendig (teuer) und nicht so sehr robust.
Inzwischen hat sich die SD-(secure digital-)-Karte allgemein völlig durchgesetzt;
für Kameras immer noch in der ursprünglichen Grösse, sonst eher als
Miniaturausführungen (micro-SD und nano-SD) z.B. in Handys, evtl. über (wieder rein mechanische) Adapter.
Die SD-Karten haben nur wenige offene Flachkontakte
und sind sehr robust. Ursprünglich waren sie gar nicht für Kameras
vorgesehen, sondern für Multimedia-Anwendungen, und hatten einen
komplizierten Verschlüsselungsmechanismus , der aber überhaupt nicht
benutzt wird.
Die Datenübertragung geschieht seriell, dafür aber mit sehr hoher Geschwindigkeit.
Leider war die erste Version der Normung der SD-Schnittstelle
nur für Maximal 1 Gigabyte ausgelegt. Die Erweiterung auf grössere
Karten war aber nicht kompatibel, also kann man in alten Kameras
(z.B. meiner IXUS 60) keine SDHC-Karten (so heisst die heute
meistverbreitete Norm) verwenden. Alte SD-Karten in neueren Kameras
zu verwenden, das geht meistens; allerdings produzieren die neueren Kameras
sehr viel grössere Bilddateien, so dass die alten Karten dann
meist eh zu schnell "voll" sind.
Als Neuestes gibt es jetzt auch noch SDXC-Karten mit Kapazitäten
über 64 Gigabytes. Für Fotoanwendungen sind solche riesigen Kapazitäten selten sinnvoll,
für Video-Film-Aufnahmen aber sehr wohl.
Interessant ist, das sich als Software-Standard für die Anordnung der Daten
in dem Speicherchip immer noch - und das ist für Edelschrott-Anwendungen wunderbar -
das System "wie eine externe Festplatte" und damit das altehrwürdige,
noch aus MS-DOS-Zeiten stammende Dateisystem FAT (file allocation table)
benutzt wird. So kann man die Karten mühelos in allen Computern lesen und beschreiben (Karten-Slot oder usb-Kartenleser vorausgesetzt). Ein Glück für alle, dass die Kamerahersteller der Versuchung widerstanden haben, jeder ein eigenes Speicherkarten-Süppchen
zu kochen.
Stative
Manche Aufnahmen sind sinnvoll überhaupt nur mit einem Stativ möglich. So z.B.
Aufnahmen von Mond und Sternen. Absolute Wackelfreiheit ist hier notwendig,
wenngleich (je nach Brenweite:) nur für einige Sekunden. Die Erddrehung erzeugt bei mehr als einigen Sekunden sonst "längliche" Sterne. Wenn also das Licht während
dieser wenigen Sekunden nicht ausreicht, muss man wohl oder übel die
ISO-Empfindlichkeit höher stellen.
Dies gilt natürlich generell bei Nacht- und Dämmerungsaufnahmen. Man wird
immer ein Stativ benutzen, denn dann wird zumindest der unbewegliche Teil der
Szenerie scharf abgebildet. Was sich bewegt, hinterlässt hingegen nur unscharfe
Spuren, die aber eventuell auch ganz schön aussehen können.
Was aber tun, wenn man kein Stativ zur Hand hat? Manchmal gibt es passende
Flächen, auf die man die Kamera stellen oder zumindest fest abstützen kann:
Schaltkästen am Strassenrand,
(unbesetzte!) Autodächer, Torpfosten, Bordsteine usw. Bildausschnitt und
Horizont sind dann zwar meist falsch, aber das kann man ja später mit
Bildbearbeitungssoftware problemlos glattbügeln. (Bei heutigen Kameras mit
hohen Megapixel-Zahlen ist der Qualitätsverlust durch Drehung und neuen
Bildausschnitt für den Hobbyfotografen immer zu verschmerzen). Wenn möglich sollte man den Selbstauslöser (timer")
verwenden. Weitere Hinweise siehe auch unter Belichtung.
Noch ein Tip:Wenn ein Photo belichtungsmässig an der Verwackelungsgrenze
ohne Stativ geschossen werden MUSS, ist es immer vorteilhaft, MEHRERE Aufnahmen zu machen. Denn der Mensch bewegt sich "rhythmisch" hin und her, d.h. es gibt in
seiner Bewegung zwei Umkehrpunkte, wo die störende Bewegung praktisch Null ist,
und mit etwas Glück erwischt man mit einer der Aufnahmen genau diesen
Zeitpunkt!. Die ist auch die Erklärung für manche Freihandaufnahmen von Personen, die trotz recht langer Belichtungszeit doch einigermassen gelungen erscheinen.
Bildstabilisatoren der Kamera oder des Objektivs ("Image Stabilizers")
helfen hier auch mit, und wenn vorhanden sollte man diesen Modus einschalten. Sie beruhigen aber nur das kameraseitige Gewackel, aber
nicht die Unruhe des Objektes.
Und noch ein Tip: Wenn man bei wenig Licht eine Szenerie oder Stimmung
auf jeden Fall und überhaupt festhalten will, die Kamera aber nicht genügend fixeren kann,
ist eine Videoaufnahme nicht die schlechteste Wahl: Denn ein Video ist eine Folge
mittelmässig kleiner, mit ca. 1/30 s aufgenommener Bildchen, die zumindestens die
Situation überhaupt mal dokumentieren. Und mit entsprechender Software kann man sich
dann später noch die brauchbarsten Bilder heraussuchen.
Image Stabilizers")
sind in viele Kameras eingebaut (bei Kameras mit Wechsekobjektiven manchmal auch in das Objektiv). Sie bekämpfen aber NUR das kameraseitige Gewackel,
nicht aber die Unruhe des Objektes selbst! Sie sind also kein Ersatz für ein Stativ, ermöglichen aber bei Motiven, die selbst nicht allzu bewegt sind, oft durchaus ruhige, also unverwackelte Freihandaufnahmen. Das führt dann zu erstaunlich guten Bildern bei wenig Licht, mit Verschlusszeiten um nur 1/10 sec. Entsprechendes passiert bei Tele-Aufnahmen: Da die Abbildung hier durch die lange Brennweite besonders stark wackelt,
wirkt die Stabilisierung hier besonders heilsam, und ermöglicht überraschend scharfe Freihand-Aufnahmen:
Der Mond, am 2021:07:18 22:40:40
mit der Canon SX40 freihand mit 1/125 s, F/5.8, 200 ISO, Brennweite 150.5 mm (35 mm equivalent: 840.5 mm) aufgenommen.
Bild 493
 Zum Vergleich unten der Mond, am 2021:04:19 21:44:55 mit Panasonic DMC-G3 mit Stativ, mit einem festen Teleobjektiv von 300 mm Brennweite, 1/160s, ISO 1600, hier auf gleiche Abbildungsgrösse gebracht: Die Qualität ist durchaus vergleichbar; die Aufnahme vom April leidet u.a. auch an leichtem Dunst in der Erdatmosphäre.
Bild 494
Zum Vergleich unten der Mond, am 2021:04:19 21:44:55 mit Panasonic DMC-G3 mit Stativ, mit einem festen Teleobjektiv von 300 mm Brennweite, 1/160s, ISO 1600, hier auf gleiche Abbildungsgrösse gebracht: Die Qualität ist durchaus vergleichbar; die Aufnahme vom April leidet u.a. auch an leichtem Dunst in der Erdatmosphäre.
Bild 494

Teleobjektive
Bild 495
 Für Allerweltsfotografie braucht man sie eher selten; für Aufnahmen in der freien Natur aber
recht oft, denn viele Tiere scheuen die Nähe des Menschen.
Das Bild zeigt ein Novoflex Pistolen-Tele 400mm, darunter ein konventionelles
Tele 500mm und schliesslich ein Spiegeltele 500mm (sehr kurz und leicht, aber feste
Blende f/8.0).
Für Allerweltsfotografie braucht man sie eher selten; für Aufnahmen in der freien Natur aber
recht oft, denn viele Tiere scheuen die Nähe des Menschen.
Das Bild zeigt ein Novoflex Pistolen-Tele 400mm, darunter ein konventionelles
Tele 500mm und schliesslich ein Spiegeltele 500mm (sehr kurz und leicht, aber feste
Blende f/8.0).
Bei Teleobjektiven
ist einiges zu beachten (Gilt sinngemäss auch für Zoom-Objektive im der
Tele-Stellung):
- erhöhte Verwacklungsgefahr durch die lange Brennweite
Eine Faustregel sagt deshalb, dass die einzustellende Belichtungszeit
mindestens so kurz wie der Kehrwert der Brennweite sein sollte, also bei 500mm
Brennweite mindestens 1/500 s kurz sein sollte, besser noch kürzer. Falls die
Kamera dies im Av-Modus nicht schon selbst macht, muss dies durch Erhöhung der
ISO-Empfindlichkeit erzwungen werden. Wenn man dies nicht beachtet, sind
Enttäuschungen vorprogrammiert. Woher weiss ich das so genau?. Ich hab's
probiert...
- Autofokus, wenn überhaupt möglich, mag keine Wolken, und klaren Himmel
schon gar nicht. Manchmal muss man sich eine Fokussierung vom Horizontbewuchs
abholen.
- das ausgewählte Objekt ist manchmal schwer zu finden. Man wünscht sich in
Zielfernrohr", nämlich mit geringerer
Vergrösserung = breiterem Gesichtsfeld. Bei meiner Canon SX40 ist dies als Funktion eingebaut, und löst elegant das Problem.
- Kameras mit crop-Faktor 1.6 oder sogar 2.0 vergrössern ( bei 2:
verdoppeln !) die effektive Brennweite. Das ist manchmal vielleicht sogar gewünscht, aber
alles wird dadurch noch wackeliger und schwerer aufzufinden.
Falls man mit Stativ arbeiten kann und genügend Zeit hat, lohnt es sich, zum Zielen
zunächst ein Normalobjektiv zu benutzen, und dann, ohne Veränderung am Stativ,
erst das Teleobjektiv zu montieren. (Geht besonders gut mit M42-Objektiven;
Bild 496
 mit Erfolg ausprobiert bei Mond-Fotografie).
mit Erfolg ausprobiert bei Mond-Fotografie).
Bei statischen Motiven und langen Belichtungszeiten wird man auch wieder den Selbstauslöser bemühen.

Unbill durch Unbilder?
Bild 497
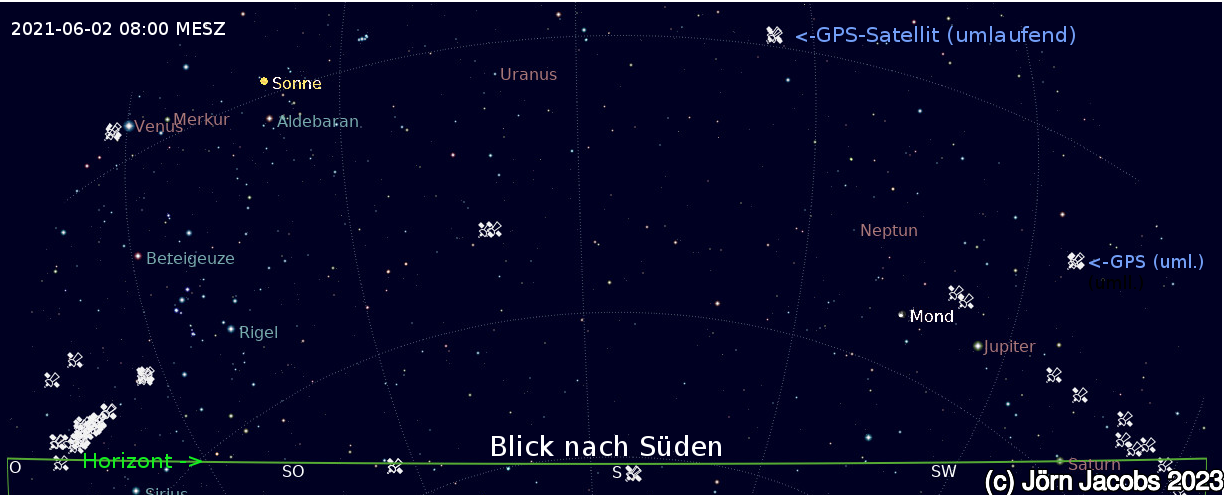 Es ist ein wenig wie bei der Landschaftsmalerei: Manche Dinge lassen sich nur
schwer, und oft überhaupt nicht, abbilden. Die heutige Zeit ist deshalb voll von
Simulationen, und die Menschheit muss lernen, damit umzugehen, was konkret heisst:
Viel fundierte Kenntnis über die realen Dinge, um dadurch immer die konkret vorliegende
Präsentation auf ihre Echtheit und vor allem ihre Relevanz zu prüfen. Das Bild zeigt
(als eine Simulation mittels des Astronomieprogramms
KStar") einen Blick in den Himmel am Tage, von Nord-Baden aus dem Blick
nach Süden gerichtet, ca. 8 Uhr MESZ; Wir sehen abgebildet Sonne und Mond,
dann die wichtigsten Sterne in dem Bereich, zwei (umlaufende) GPS-Satelliten
und eine Unmenge (geostationäre) Telekommunikationssatelliten (besonders links und
rechts am Bildrand, einer in der Mitte). Einen guten ersten Eindruck vom
Geschehen bekommt man damit; aber es ist nur eine Simulation. Die Sterne
sind selbst bei wolkenlosem Himmel am hellichten Tage NIEMALS zu sehen
(Ausnahme: Sonnennahe Planeten während der Dämmerung). Ausserdem: ist das
wirkliche Geschehen VIEL komlizierter, die Zahl der Sterne ist millionenfach
grösser, und die Zahl der Satelliten, die seit gut 60 Jahren "da oben" kreisen,
bestimmt etliche hundert mal grösser als in der Simulation.
Es ist ein wenig wie bei der Landschaftsmalerei: Manche Dinge lassen sich nur
schwer, und oft überhaupt nicht, abbilden. Die heutige Zeit ist deshalb voll von
Simulationen, und die Menschheit muss lernen, damit umzugehen, was konkret heisst:
Viel fundierte Kenntnis über die realen Dinge, um dadurch immer die konkret vorliegende
Präsentation auf ihre Echtheit und vor allem ihre Relevanz zu prüfen. Das Bild zeigt
(als eine Simulation mittels des Astronomieprogramms
KStar") einen Blick in den Himmel am Tage, von Nord-Baden aus dem Blick
nach Süden gerichtet, ca. 8 Uhr MESZ; Wir sehen abgebildet Sonne und Mond,
dann die wichtigsten Sterne in dem Bereich, zwei (umlaufende) GPS-Satelliten
und eine Unmenge (geostationäre) Telekommunikationssatelliten (besonders links und
rechts am Bildrand, einer in der Mitte). Einen guten ersten Eindruck vom
Geschehen bekommt man damit; aber es ist nur eine Simulation. Die Sterne
sind selbst bei wolkenlosem Himmel am hellichten Tage NIEMALS zu sehen
(Ausnahme: Sonnennahe Planeten während der Dämmerung). Ausserdem: ist das
wirkliche Geschehen VIEL komlizierter, die Zahl der Sterne ist millionenfach
grösser, und die Zahl der Satelliten, die seit gut 60 Jahren "da oben" kreisen,
bestimmt etliche hundert mal grösser als in der Simulation.
Ein reales Himmelsfoto gelingt also nur nachts bei sternklarem Wetter:
Kamera EOS M10 nach oben gerichtet, 8mm-Fisheye-Objektiv,
crop-Faktor 1,6, ISO 1600, und 30 sec Belichtungszeit:
Bild 498

(besseres Bild und dazu genau passende Simulation zu gleichem Zeitpunkt und Himmels-Sektor FEHLT NOCH)

 "Derselbe Himmel", Kamera horizontal nach Osten gerichtet: EOS M10, ISO 800, 15 sec Belichtungszeit. Rechts oben ist sehr schön das Sternbild Orion zu sehen:
,Bild 499
"Derselbe Himmel", Kamera horizontal nach Osten gerichtet: EOS M10, ISO 800, 15 sec Belichtungszeit. Rechts oben ist sehr schön das Sternbild Orion zu sehen:
,Bild 499


Zoomobjektive
Gehören zur Standard-Erstausrüstung jeder heutigen Wechselobjektiv-Kamera als so
genanntes kit-Objektiv. Sie ermöglichen die kontinuierliche Einstellung der
effektiven Brennweite in weiten Grenzen, üblicherweise vom Weitwinkelbereich
bis in den Teleobjektiv-Bereich. Dieses hat seinen Preis in einer deutlich
geringeren Lichtstärke. Wenn wenig Licht vorherrscht, kann es deshalb
Festbrennweite", also z.B. auf ein Objektiv 50/2.0 auszuweichen. Die Möglichkeit, mit
dem Zoomobjektiv schon vor bzw während der Aufnahme den Bildausschnitt ziemlich
genau festzulegen, hat heute an Bedeutung verloren. Die hochauflösenden
Bildsensoren ermöglichen auch kleinere Bildausschnitte guter Qualität, die man
mit einer Bildverarbeitungssoftware ja leicht nachträglich festlegen kann.
So etwas war für den Hobby-Fotografen früherer Zeiten aus Aufwands- und Kostengründen praktisch völlig undenkbar. Zu bedenken ist übrigens auch, dass das Heranzoomen die Brennweite vergrössert, die Blendenwerte dadurch ungünstiger werden, und damit die Verwackelungsgefahr steigt. Meine Empfehlung bei Zoomaufnahmen: Anfangs oder hinterher noch eine wenig oder gar nicht gezoomte Aufnahme desselben Motivs machen. Die ist dann auf jeden Fall schärfer, wenn auch schlimmstenfalls etwas weniger aufgelöst
("grobkörniger").
Weitwinkelobjektive
Sind für manche Aufnahmesituationen natürlich sehr günstig: Immer wenn die Szene insgesamt nicht in eine Normalobjektivs-Aufnahme passt (und der Hobby-Fotograf keinen Schritt zurückweichen kann), sind sie der Retter in der Not. Typischer Fall: Eine Kirche soll mit Kirchturm fotografiert werden. Die üblichen Zoom-Objektive (und fast alle in die Taschenkameras eingebauten Objektive) bringen diese Möglichkeit gleich mit. Und der Vorteil ist, dass man sich bei der Weitwinkelstellung in Richtung grösserer Lichstärke bewegt, also keine Probleme mit zu wenig Licht, Verwackelung usw. bekommen wird.
Hugin".
Bild 500
 Superweitwinkelobjektive ("Fisheye") bringen einen Bereich von nahe 180 Grad auf
das Bild, und damit extreme Bildverzerrungen, die aber oft sehr reizvoll und
keineswegs immer störend sind. Es wird generell behauptet (und das stimmt!),
dass die Füsse des Fotografen immer mit auf dem Bild sind...
Superweitwinkelobjektive ("Fisheye") bringen einen Bereich von nahe 180 Grad auf
das Bild, und damit extreme Bildverzerrungen, die aber oft sehr reizvoll und
keineswegs immer störend sind. Es wird generell behauptet (und das stimmt!),
dass die Füsse des Fotografen immer mit auf dem Bild sind...
Bild 501
 Hier der Beweis:
Unser grüner Balkon. Kamera EOS M10 mit Superweitwinkelobjektiv 8mm, d.h.
ca 12mm effektiv.
Hier der Beweis:
Unser grüner Balkon. Kamera EOS M10 mit Superweitwinkelobjektiv 8mm, d.h.
ca 12mm effektiv.
Die allfälligen Verzerrungs-Effekte bei Superweitwinkelobjektiven werden in den
realen Fällen der crop-Faktoren 1.6 oder 2.0 um einiges gemildert: Ein Fisheye von
z.B. 8mm wirkt dann "nur" wie 12 mm bzw. 16 mm. Für Aufnahmen bei
Familienfesten oder ähnlichem ist es also doch noch recht gut geeignet. Ebenso für leichte Verfremdungseffekte aller
Art: Technisch gradlinige Gebilde werden angenehm rundlich (Wuppertaler
Schwebebahn);
Bild 502
 "klein,ganz nah" zu "gross, aber weit weg"
werden wie von Zauberhand verbunden.
Bild 503
"klein,ganz nah" zu "gross, aber weit weg"
werden wie von Zauberhand verbunden.
Bild 503
 Ein besonderer Fall ist der gesamte sichtbare Sternenhimmel in einer klaren Nacht: Hier muss die Kamera auf den Rücken gelegt werden, auf eine waagerechte Fläche, so dass möglichst viel Himmel eingefangen wird. Umliegende Gebäude und Bäume werden den Rand der Aufnahme bilden. Dennoch sollte die Kamera möglichst hoch aufgelegt werden. So eine
Aufnahme habe ich noch nicht geschafft. Ich kann aber das Ergebnis eines Vorversuchs mit einer CHDK-gesteuerten A570IS in Zoom-Weitwinkelstellung zeigen:
Daten: ISO-200 3072x2304 (15.0s) f/3.2 f(35)=37mm
Bild 504
Ein besonderer Fall ist der gesamte sichtbare Sternenhimmel in einer klaren Nacht: Hier muss die Kamera auf den Rücken gelegt werden, auf eine waagerechte Fläche, so dass möglichst viel Himmel eingefangen wird. Umliegende Gebäude und Bäume werden den Rand der Aufnahme bilden. Dennoch sollte die Kamera möglichst hoch aufgelegt werden. So eine
Aufnahme habe ich noch nicht geschafft. Ich kann aber das Ergebnis eines Vorversuchs mit einer CHDK-gesteuerten A570IS in Zoom-Weitwinkelstellung zeigen:
Daten: ISO-200 3072x2304 (15.0s) f/3.2 f(35)=37mm
Bild 504
 Die Aufnahme Vom Sternenhimmel zeigt bereits deutlich
diese kleinen Striche, denn die Belichtungszeit betrug ca. 1 Minute. Interessant
sind die beiden längeren. völlig geraden Striche rechts oben. Die rote Farbe
deutet auf die Positionslichter von Flugzeugen hin.
richtige" Aufnahme muss also die Belichtungszeit kürzer sein. Dazu dann die ISO-Einstellung möglichst hoch (1600 oder mehr), was bei einer Wechselobjektiv-Kamera mit ihrem wesentlich grösseren Fotosensor möglich ist. Mal sehen...
Die Aufnahme Vom Sternenhimmel zeigt bereits deutlich
diese kleinen Striche, denn die Belichtungszeit betrug ca. 1 Minute. Interessant
sind die beiden längeren. völlig geraden Striche rechts oben. Die rote Farbe
deutet auf die Positionslichter von Flugzeugen hin.
richtige" Aufnahme muss also die Belichtungszeit kürzer sein. Dazu dann die ISO-Einstellung möglichst hoch (1600 oder mehr), was bei einer Wechselobjektiv-Kamera mit ihrem wesentlich grösseren Fotosensor möglich ist. Mal sehen...
Trotz ihrer ausgeprägten Verzerrungen an den Rändern eignen sich die
Fisheye-Objektive doch für Aufnahmen von Personengruppen, besonders wenn dank
crop-Faktor 1 .6 oder 2.0 diese Objektive nur *halb so schlimm* verzerren. Man stellt die Entfernung auf "mittel-fern", und muss daran nichts mehr ändern geschweige denn auf einen sonst ja möglicherweise langsamen Autofokus warten, verpasst daher also auch keinen typischen, bedeutsamen Moment oder eine einmalige Situationskomik.
Wer die Ausgabe von nahe 300 € für ein Gutes Super-Weitwinkelbjektiv scheut, kann erst mal mit einen Weitwinkelvorsatz experimentieren, den er in das Filtergewinde eines vorhanden Objektivs einschraubt. Probeaufnahmen zeigen dann ja, ob das Ganze noch nach Qualitätsanspruch und Geschmack des Hobbyisten ist.
Bild 505
 Diese Vorsätze lassen sich sogar auch bei einigen Taschenkameras verwenden,
allerdings nur, wenn man einen passenden Adaptertubus hat. Hier eine
A570IS mit riesigem Televorsatz (Weitwinkel gibt's auch), der
nicht allzuviel bringt, aber auch nicht viel kostet.
Diese Vorsätze lassen sich sogar auch bei einigen Taschenkameras verwenden,
allerdings nur, wenn man einen passenden Adaptertubus hat. Hier eine
A570IS mit riesigem Televorsatz (Weitwinkel gibt's auch), der
nicht allzuviel bringt, aber auch nicht viel kostet.
Dazu noch eine Anmerkung, und zwar bezüglich Autofokus
(gilt für alle Vorsätze): Die meisten Kameras mögen sie nicht,
da diese wohl zu viel Licht wegnehmen. Hier hilft nur ausprobieren,
und schlimmstenfalls manuell scharfstellen.
ZU GUTER LETZT...
Habe das Manuskript vor kurzem verlegt; bin derzeit ja noch Selbstverleger; seitdem die grosse Suche. Finde es schwer. Wie findet ihr es?
(:-()))))
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ADDENDUM 08.2022, (gekürzt), ein Anhang.
Vielleicht sowas wie ein blog "en bloc".
ADDENDUM:click here!


 Als Überbleibsel von alten Spiegelreflexkameras ("SLRs") habe ich noch
einige Objektive mit M 42- und PK-Anschluss.
Darunter Raritäten wie ein echtes Tessar Zeiss Jena DDR oder ein
1,3 kg schweres Zoomobjektiv Universa 1:4,5/ 70-230, Bild 2.
Als Überbleibsel von alten Spiegelreflexkameras ("SLRs") habe ich noch
einige Objektive mit M 42- und PK-Anschluss.
Darunter Raritäten wie ein echtes Tessar Zeiss Jena DDR oder ein
1,3 kg schweres Zoomobjektiv Universa 1:4,5/ 70-230, Bild 2.
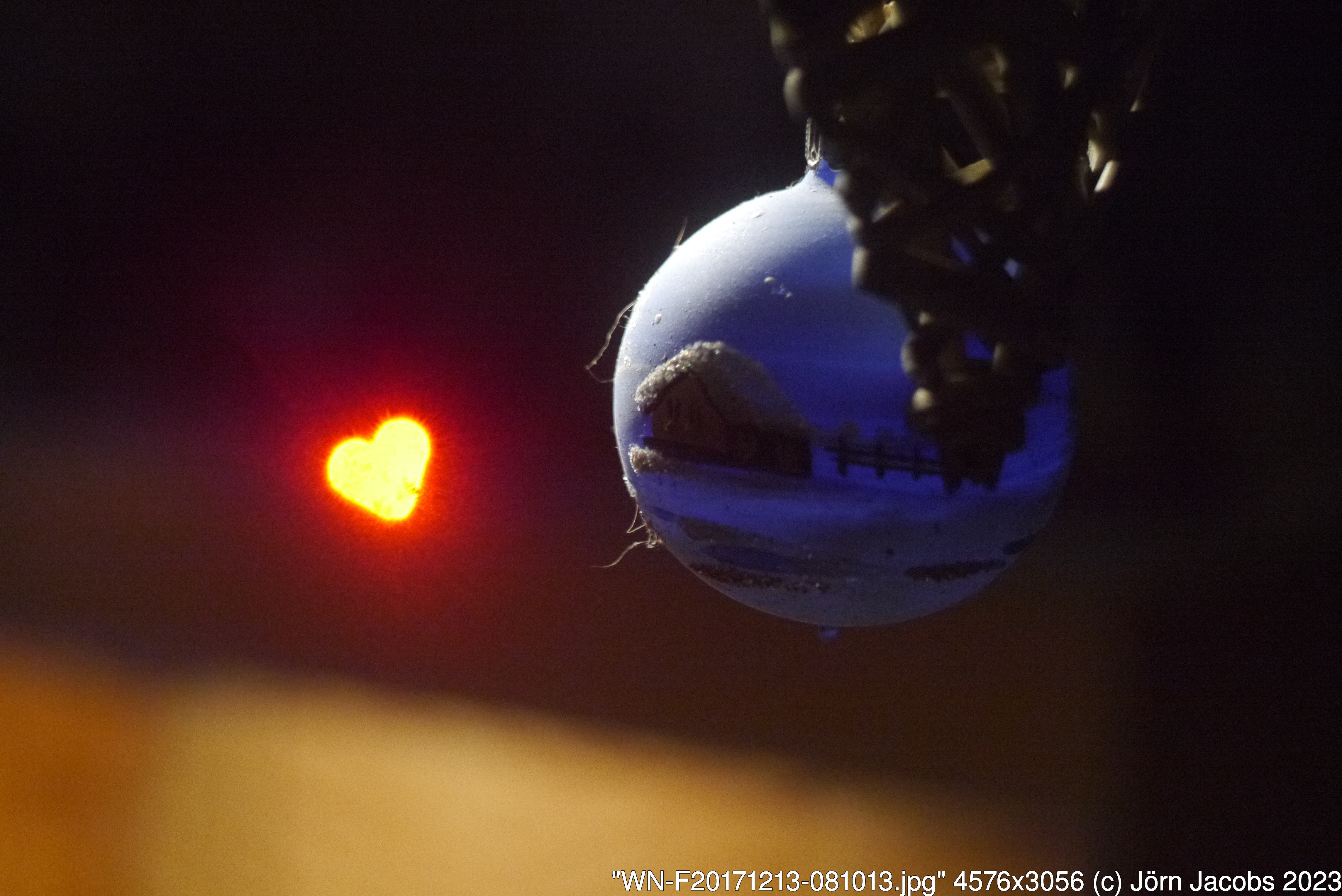 Bild 4
Bild 4
 Achtung: die Spitzlichter müssen im Unschärfebereich der
Szene liegen, sonst funktioniert es nicht!
Achtung: die Spitzlichter müssen im Unschärfebereich der
Szene liegen, sonst funktioniert es nicht!


 Bild 20: Akzeptable Schärfe ab 1m bis einschl. 3 m erreicht man
nur mit völlig abgeblendetem Objektiv, was lange Belichtungszeiten
bzw. hohe ISO-Zahlen und ein Stativ erforderte.
Kamera: Canon EOS M10, Objektiv: Brw.: 50.0 mm Entf.: 1.82 m Blende:
F/ 36.0 , VsZeit 1/50 s, Empf.: 6400 ISO.
Bild 20: Akzeptable Schärfe ab 1m bis einschl. 3 m erreicht man
nur mit völlig abgeblendetem Objektiv, was lange Belichtungszeiten
bzw. hohe ISO-Zahlen und ein Stativ erforderte.
Kamera: Canon EOS M10, Objektiv: Brw.: 50.0 mm Entf.: 1.82 m Blende:
F/ 36.0 , VsZeit 1/50 s, Empf.: 6400 ISO.




 Ein weiterer, manchmal gangbarer Trick:
Ein weiterer, manchmal gangbarer Trick: Bild 26: Tiefenschärfenprobleme kann man elegant umschiffen, indem man mit einem Tele aus bewusst grösserer Entfernung (hier ca. 30m) fotografiert. So kommt die fast schon verwirrende Vielfalt dieser Blumenanflanzung gut zur Geltung. Kamera Canon PowerShot SX40 HS, 1/320s, F/5.8, ISO 100, Brennw. 105.4 mm (35 mm-Entspr. ist 588 mm), Schärfezone laut EXIF-header: 28.87 - 34.43 m. Typisch für Tele-Aufnahmen ist auch die (hier durchaus erwünschte) Unschärfe des sehr fernen, hier etwa 150m enfernten Hintergrundes.
Bild 26: Tiefenschärfenprobleme kann man elegant umschiffen, indem man mit einem Tele aus bewusst grösserer Entfernung (hier ca. 30m) fotografiert. So kommt die fast schon verwirrende Vielfalt dieser Blumenanflanzung gut zur Geltung. Kamera Canon PowerShot SX40 HS, 1/320s, F/5.8, ISO 100, Brennw. 105.4 mm (35 mm-Entspr. ist 588 mm), Schärfezone laut EXIF-header: 28.87 - 34.43 m. Typisch für Tele-Aufnahmen ist auch die (hier durchaus erwünschte) Unschärfe des sehr fernen, hier etwa 150m enfernten Hintergrundes.













 Das zweite Bild (37) zeigt eine Aufnahme aus einer Entfernung von 140 cm.
Das zweite Bild (37) zeigt eine Aufnahme aus einer Entfernung von 140 cm.



 Bild 40
Bild 40

 Bild 41 (mit gerundeten Ecken)
Bild 41 (mit gerundeten Ecken) Nach dem "Zurückweichen/ Rückvergrössern" auf etwa den doppelten Abstand ist die Schärfentiefe schon akzeptabel, was ein Vergleich mit dem oberen Bild zeigt.
Nach dem "Zurückweichen/ Rückvergrössern" auf etwa den doppelten Abstand ist die Schärfentiefe schon akzeptabel, was ein Vergleich mit dem oberen Bild zeigt. Noch besser wird es bei noch grösserem, ca. 3-fachen Abstand, hier an einem einfachen Blumenmotiv gezeigt:
Noch besser wird es bei noch grösserem, ca. 3-fachen Abstand, hier an einem einfachen Blumenmotiv gezeigt:
 43,
43,

 44:
44:

 Anmerkung zu variiertem Bildabstand bzw. unterschiedlichen Brennweiten:
Anmerkung zu variiertem Bildabstand bzw. unterschiedlichen Brennweiten:
 Das schöne Gesicht eines Menschen wollte ich aus einer Reihe von Gründen hier nicht als Beispiel nehmen. Hunde sitzen nicht ruhig genug, Katzen sind schwer zu dirigieren, Eulen zu selten, und wer weiss, wie sie bei Nahaufnahmen reagieren...
Ich habe mich deshalb hier im Haus umgeschaut und die Puppe links aus ihrer Zweisamkeit entführt, und möchte an ihr
die Bedeutung der Brennweite bzw. Entfernung zum Objekt auf die Gesichtsproportionen zeigen. Eine Puppe sitzt still und hat immer dasselbe Gesicht, wenngleich der Gesichtsausdruck doch noch ein wenig von der Beleuchtung abhängt. Camera: Canon PowerShot SX40 HS, CCD-Breite: 6.20mm, sehr weiter Zoom-Bereich. Das erste Bild (46) ist eine Nahaufnahme. Die folgenden 5 Bilder wurden aus verschiedenen Entfernungen bei jeweils möglichst gleichem Bildausschnitt mit einem Zoom-Objektiv aufgenommen, und die Bilder 2...6 dem Ausschnitt des ersten Bildes möglichst genau angepasst.
Das schöne Gesicht eines Menschen wollte ich aus einer Reihe von Gründen hier nicht als Beispiel nehmen. Hunde sitzen nicht ruhig genug, Katzen sind schwer zu dirigieren, Eulen zu selten, und wer weiss, wie sie bei Nahaufnahmen reagieren...
Ich habe mich deshalb hier im Haus umgeschaut und die Puppe links aus ihrer Zweisamkeit entführt, und möchte an ihr
die Bedeutung der Brennweite bzw. Entfernung zum Objekt auf die Gesichtsproportionen zeigen. Eine Puppe sitzt still und hat immer dasselbe Gesicht, wenngleich der Gesichtsausdruck doch noch ein wenig von der Beleuchtung abhängt. Camera: Canon PowerShot SX40 HS, CCD-Breite: 6.20mm, sehr weiter Zoom-Bereich. Das erste Bild (46) ist eine Nahaufnahme. Die folgenden 5 Bilder wurden aus verschiedenen Entfernungen bei jeweils möglichst gleichem Bildausschnitt mit einem Zoom-Objektiv aufgenommen, und die Bilder 2...6 dem Ausschnitt des ersten Bildes möglichst genau angepasst. Bild 47
Bild 47
 Bild 1:
ISO 250, 1/30 s, f/2.7
Entfernung: 0.14m, Brennw.: 4.3mm (35er: 25mm)
Bild 1:
ISO 250, 1/30 s, f/2.7
Entfernung: 0.14m, Brennw.: 4.3mm (35er: 25mm) Bild 49
Bild 49
 Bild 3:
ISO 800 (1/50) f/4.5
Entfernung: 0.57m, Brennweite: 23.4mm (35er: 136mm)
Bild 3:
ISO 800 (1/50) f/4.5
Entfernung: 0.57m, Brennweite: 23.4mm (35er: 136mm) Bild 51
Bild 51
 Bild 5:
ISO 800, 1/30 s, f/5.8
Entfernung: 1.74m, Brennweite: 100.0mm (35er: 581mm)
Bild 5:
ISO 800, 1/30 s, f/5.8
Entfernung: 1.74m, Brennweite: 100.0mm (35er: 581mm)
 Wenn also die Sonne dem Haarkranz einen goldenen Schein geben soll, das Gesicht
der Person aber als wesentliches Merkmal gut erkennbar (und hübsch!) aussehen,
MUSS der Blitz benutzt werden.
Wenn also die Sonne dem Haarkranz einen goldenen Schein geben soll, das Gesicht
der Person aber als wesentliches Merkmal gut erkennbar (und hübsch!) aussehen,
MUSS der Blitz benutzt werden.


 Bild 56
Bild 56


 Bild 58
Bild 58
 Es empfiehlt sich, bei einer neuen oder unbekannten Kamera herauszufinden, wie man den eingebauten Blitz ausschaltet. Dennoch: Aus Versehen habe ich hier geblitzt (linkes Bild); viel natürlicher wirkt das ungeblitzte Bild (rechts).
Es empfiehlt sich, bei einer neuen oder unbekannten Kamera herauszufinden, wie man den eingebauten Blitz ausschaltet. Dennoch: Aus Versehen habe ich hier geblitzt (linkes Bild); viel natürlicher wirkt das ungeblitzte Bild (rechts).
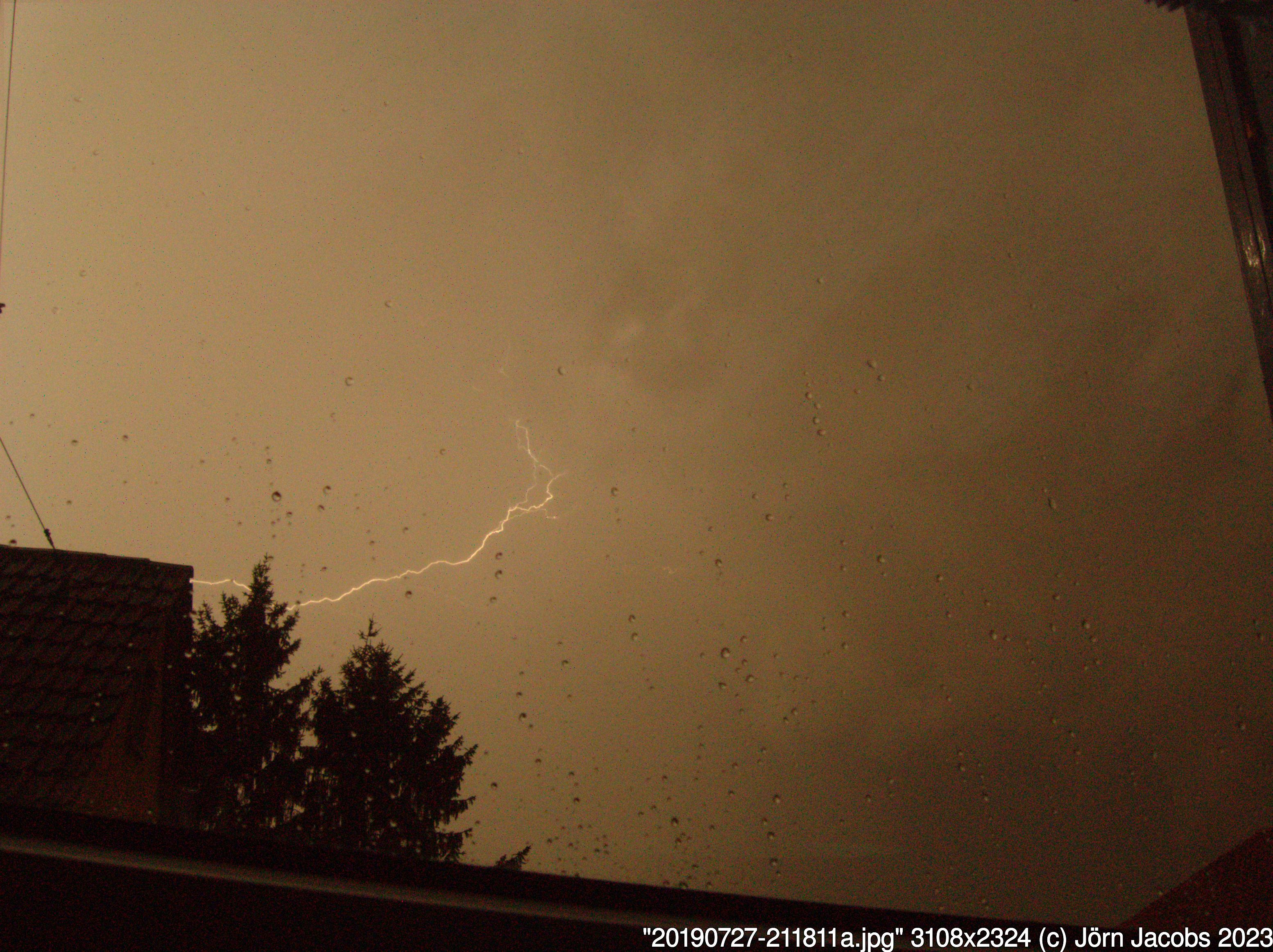 Mit der Bewegungserkennungs-Software von CHDK gelingt dies recht gut:
Man richtet die Kamera,
wenn das erste Donnergrollen ein Gewitter "im Anzug"
signalisiert,
fest (Stativ oder passende Unterlage) auf einen Bereich des (am besten: Abend-) Himmels, ein wenig
Horizont ist auch nett, und das in der Kamera laufende Skript wartet auf die auslösenden Ereignisse. Das
kann eine ganze Nacht andauern, deswegen die Kamera dann mit Netzteil oder externem Akku betreiben.
Die Kamera wird auch viele wenig brauchbare Bilder liefern, aber die kann man ja löschen.
Die (manuelle) Belichtungszeit sollte 1 s oder länger sein; dadurch wird der Abendhimmel
heller und die Wahrscheinlichkeit, einen oder mehrere Folgeblitze zu erwischen, steigt auch.
Das erste Foto meiner Versuche war etwas mager, aber gelang schon mal im Prinzip:
Mit der Bewegungserkennungs-Software von CHDK gelingt dies recht gut:
Man richtet die Kamera,
wenn das erste Donnergrollen ein Gewitter "im Anzug"
signalisiert,
fest (Stativ oder passende Unterlage) auf einen Bereich des (am besten: Abend-) Himmels, ein wenig
Horizont ist auch nett, und das in der Kamera laufende Skript wartet auf die auslösenden Ereignisse. Das
kann eine ganze Nacht andauern, deswegen die Kamera dann mit Netzteil oder externem Akku betreiben.
Die Kamera wird auch viele wenig brauchbare Bilder liefern, aber die kann man ja löschen.
Die (manuelle) Belichtungszeit sollte 1 s oder länger sein; dadurch wird der Abendhimmel
heller und die Wahrscheinlichkeit, einen oder mehrere Folgeblitze zu erwischen, steigt auch.
Das erste Foto meiner Versuche war etwas mager, aber gelang schon mal im Prinzip:
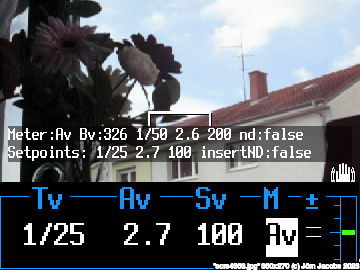
 Es gibt, wie auch schon weiter
oben erwähnt, Adapter für einige Anschlüsse, aber
schon aus mechanischen Gründen (Durchmesser, Auflagemass) nicht unbedingt für alle. Ich benutze z.B:
Es gibt, wie auch schon weiter
oben erwähnt, Adapter für einige Anschlüsse, aber
schon aus mechanischen Gründen (Durchmesser, Auflagemass) nicht unbedingt für alle. Ich benutze z.B:
 (mütterlicherseits) E.P. (ca. 1880 -1952) war schon während seiner
Zeit als Offizier der kaiserlichen Marine und als
Schiffsingenieur ein begnadeter Hobby-Fotograf
und nach dem 1. Weltkrieg dann u.a. auch als Fotograf tätig. Einige Fotos sind
überliefert, die zugleich Zeitdokumente und Kunstwerke sind, z.B. das Kinderbild von meiner Mutter und ihrer Schwester, oder das Bild einer Roma-Familie,
oder einfach die Dorfstrasse von Gr. Ippener im Schnee.
(mütterlicherseits) E.P. (ca. 1880 -1952) war schon während seiner
Zeit als Offizier der kaiserlichen Marine und als
Schiffsingenieur ein begnadeter Hobby-Fotograf
und nach dem 1. Weltkrieg dann u.a. auch als Fotograf tätig. Einige Fotos sind
überliefert, die zugleich Zeitdokumente und Kunstwerke sind, z.B. das Kinderbild von meiner Mutter und ihrer Schwester, oder das Bild einer Roma-Familie,
oder einfach die Dorfstrasse von Gr. Ippener im Schnee.


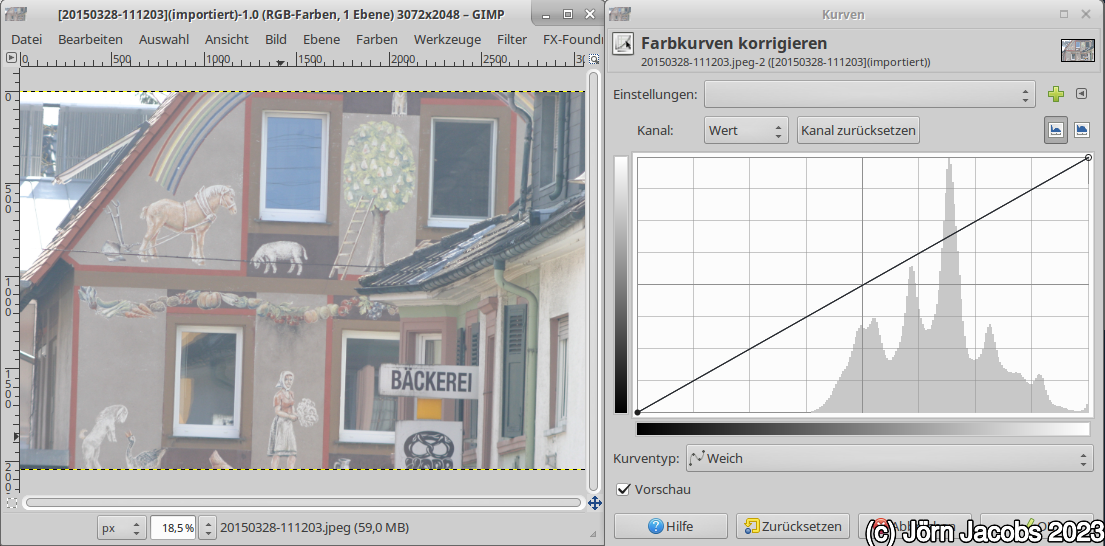 Bild 66
Bild 66
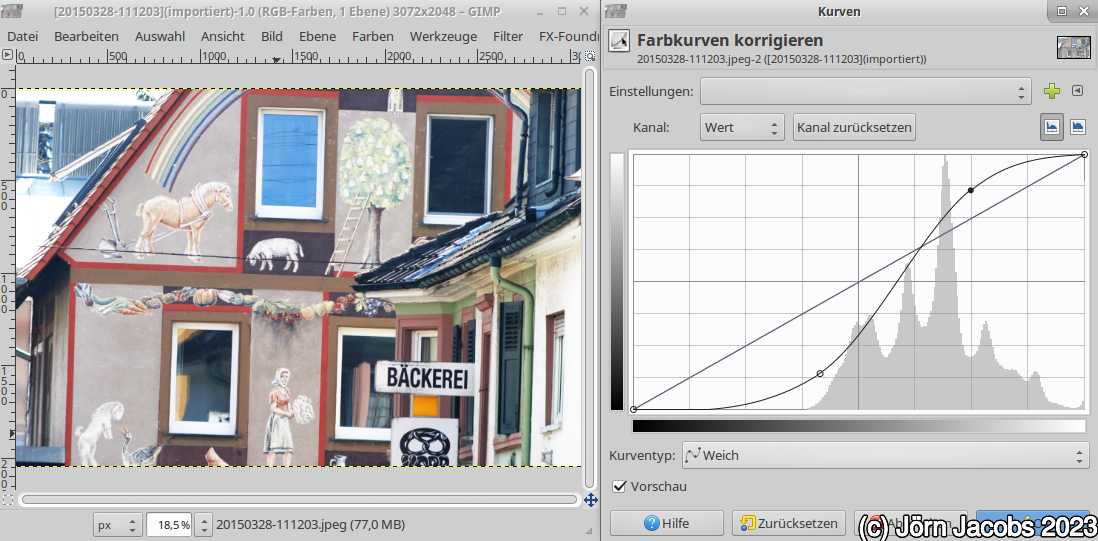
 Es gibt Situationen, in denen man ein schlechtes Foto in Kauf nimmt, um überhaupt einen Eindruck mit nach Hause nehmen zu können. So ein Fall ist das folgende Bild 67, das vom Donnersberg (Rheinland-Pfalz) aus vormittags in Richtung Osten aufgenommen wurde. Die Sicht war enttäuschend schlecht, alles war von einem Dunstschleier überzogen. Umso erstaunlicher war allerdings, nachträglich zuhause mit Bildverarbeitung vorgenommen, die Wirkung einer Kontrastanhebung, die daraus ein zwar hässliches, aber doch wesentlich informativeres Bild (Bild 68, rechts) gemacht hat.
Es gibt Situationen, in denen man ein schlechtes Foto in Kauf nimmt, um überhaupt einen Eindruck mit nach Hause nehmen zu können. So ein Fall ist das folgende Bild 67, das vom Donnersberg (Rheinland-Pfalz) aus vormittags in Richtung Osten aufgenommen wurde. Die Sicht war enttäuschend schlecht, alles war von einem Dunstschleier überzogen. Umso erstaunlicher war allerdings, nachträglich zuhause mit Bildverarbeitung vorgenommen, die Wirkung einer Kontrastanhebung, die daraus ein zwar hässliches, aber doch wesentlich informativeres Bild (Bild 68, rechts) gemacht hat.


 gut belichtet, so dass es dem Motiv entsprechend
entweder besonders realistisch aussieht (affirmative Abbildung)
gut belichtet, so dass es dem Motiv entsprechend
entweder besonders realistisch aussieht (affirmative Abbildung) Der Moment macht das Bild. Kamera Canon SX40, die gerade greifbar herumlag und wie praktisch alle heutigen "richtigen" Kameras innert einer halben Sekunde knipsbereit ist.
Der Moment macht das Bild. Kamera Canon SX40, die gerade greifbar herumlag und wie praktisch alle heutigen "richtigen" Kameras innert einer halben Sekunde knipsbereit ist. 
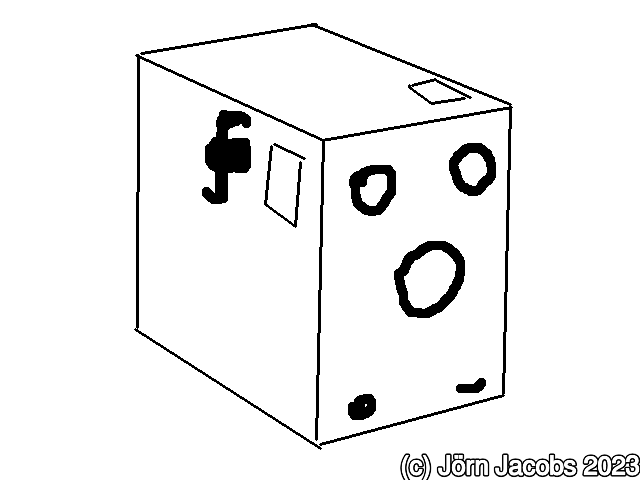
 Der "treue" Eindruck der Box wurde noch unterstrichen durch die zwei "Augen",
das waren die beiden
kleinen Spiegelsucher, die oben eingebaut waren, und jeweils dann von oben
beschaut die Szene klein, aber sehr plastisch im Hoch- oder Querformat abbildeten.
Der "treue" Eindruck der Box wurde noch unterstrichen durch die zwei "Augen",
das waren die beiden
kleinen Spiegelsucher, die oben eingebaut waren, und jeweils dann von oben
beschaut die Szene klein, aber sehr plastisch im Hoch- oder Querformat abbildeten. Mit ihr habe ich als teenager alle möglichen Fotos gemacht. Natürlich nur
in Schwarzweiss, denn Farbfilme und -abzüge waren viel zu teuer!
Für Innenaufnahmen gab es ein Blitzgerät, in dem Einmal-Blitzbirnen elektrisch
gezündet wurden. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen übrigens, denn eine
(grosse) Blitzbirne kostete 40 Pfennig, etwa so viel wie eine
Kinderfahrkarte für die U-Bahn-Fahrt nach Hamburg, machte ein
deutliches Explosionsgeräusch und hinterliess den Geruch von verbranntem Plastik.
Mit ihr habe ich als teenager alle möglichen Fotos gemacht. Natürlich nur
in Schwarzweiss, denn Farbfilme und -abzüge waren viel zu teuer!
Für Innenaufnahmen gab es ein Blitzgerät, in dem Einmal-Blitzbirnen elektrisch
gezündet wurden. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen übrigens, denn eine
(grosse) Blitzbirne kostete 40 Pfennig, etwa so viel wie eine
Kinderfahrkarte für die U-Bahn-Fahrt nach Hamburg, machte ein
deutliches Explosionsgeräusch und hinterliess den Geruch von verbranntem Plastik.  Bildbeispiele: Die Dokumentation
Bildbeispiele: Die Dokumentation  "Vaters Auto im Schlamm" Bild 72,
"Vaters Auto im Schlamm" Bild 72,
 dann meine Star-Aufnahme "1963, Hamburg: Mönkebergstrasse bei Nacht",
Bild 73,
dann meine Star-Aufnahme "1963, Hamburg: Mönkebergstrasse bei Nacht",
Bild 73,
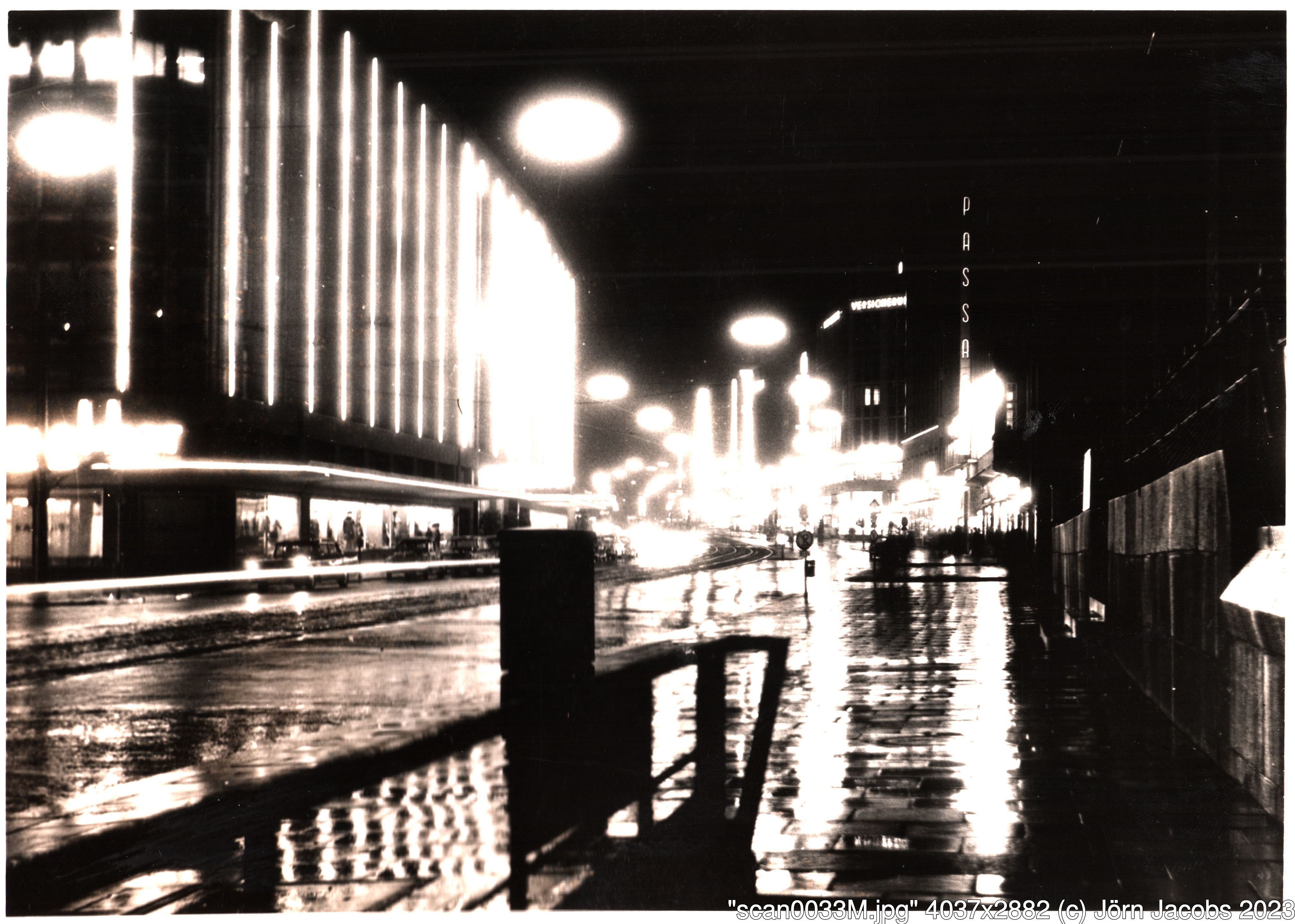

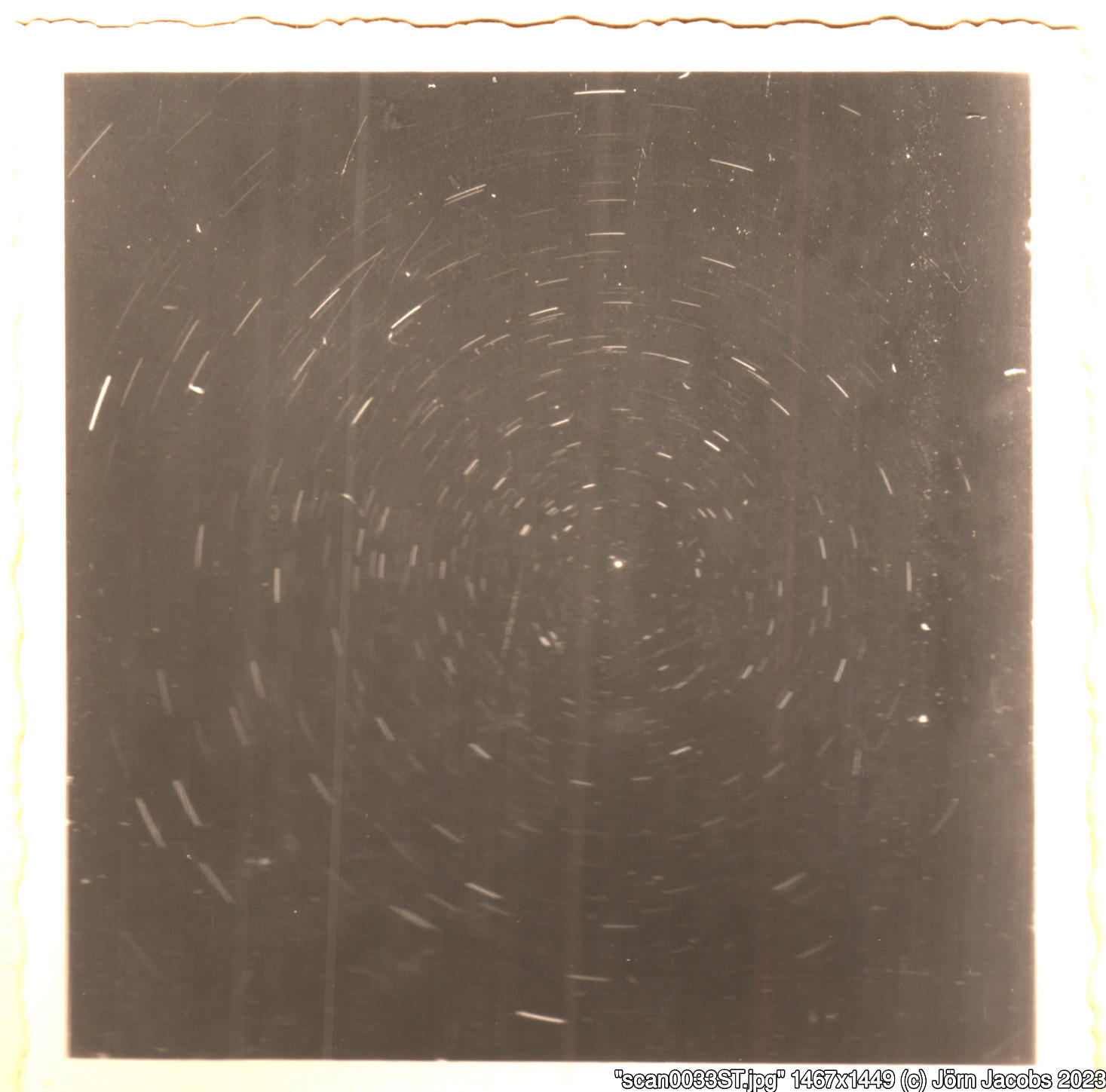 und schliesslich, und damit habe ich bei meinem Physiklehrer geprahlt,
das Bild 74 "Sterne rund um den Polarstern",
mit Blende f/4.5 und 1/2 Stunde Belichtungszeit.
Dazu brauchte man ein Stativ, und einen "Drahtauslöser mit Feststellschraube".
und schliesslich, und damit habe ich bei meinem Physiklehrer geprahlt,
das Bild 74 "Sterne rund um den Polarstern",
mit Blende f/4.5 und 1/2 Stunde Belichtungszeit.
Dazu brauchte man ein Stativ, und einen "Drahtauslöser mit Feststellschraube". 
 Das ergab dann diese neckischen Rhombusfotos. Bild 75: Heidelberg, 1959. Übrigens das
Geburtsjahr meiner Frau, einer Heidelbergerin. Als Kind wusste ich NICHT, dass
ich Jahrzehnte später hier wohnen würde...
Das ergab dann diese neckischen Rhombusfotos. Bild 75: Heidelberg, 1959. Übrigens das
Geburtsjahr meiner Frau, einer Heidelbergerin. Als Kind wusste ich NICHT, dass
ich Jahrzehnte später hier wohnen würde... Der Sucher war oben auf dem Kameragehäuse montiert und in 2 Stellungen ("nah"
und "fern") arretierbar. Die Kamera ist wohl nach dem Auslösen noch "verrückt"
(ge)worden, deshalb die exzentrische Bildgestaltung!
Der Sucher war oben auf dem Kameragehäuse montiert und in 2 Stellungen ("nah"
und "fern") arretierbar. Die Kamera ist wohl nach dem Auslösen noch "verrückt"
(ge)worden, deshalb die exzentrische Bildgestaltung!
 Eine edle Kleinbild-Kompaktkamera; sie
passte zusammengeklappt sehr gut in eine Jackentasche.Um 1970 gebraucht gekauft für DM
300.- bei Foto-Brell in Frankfurt. Sie hat mich auf unzähligen Reisen
der 70er Jahre begleitet. Sie hat einen gekuppelten Entfernungsmesser, die
Entfernungseinstellung ist schnell und direkt (das ganze Linsenpaket wird
verschoben) und im geschlosssenen Zustand steht die Kamera mechanisch bedingt
immer auf Unendlich. Das war absolut genial, da sehr viele Aufnahmen von
Unendlich ausgehend schnell fokussiert werden können. Leider hatte sie keinen Belichtungsmesser eingebaut (das
hatte wohl erst das Modell IIIc (?); ich kaufte mir deshalb einen kleinen
Gossen Sixtino für ca. DM 70.-. Unzählige superscharfe Dias (auf Kodachrome
II, später Kodachrome 25 genannt), der nur 40 ASA (heute: 40 ISO)
Empfindlichkeit hatte, sind damit entstanden (... und durch die Zeitläufte grösstenteils verschwunden... (;-|) ).
Eine edle Kleinbild-Kompaktkamera; sie
passte zusammengeklappt sehr gut in eine Jackentasche.Um 1970 gebraucht gekauft für DM
300.- bei Foto-Brell in Frankfurt. Sie hat mich auf unzähligen Reisen
der 70er Jahre begleitet. Sie hat einen gekuppelten Entfernungsmesser, die
Entfernungseinstellung ist schnell und direkt (das ganze Linsenpaket wird
verschoben) und im geschlosssenen Zustand steht die Kamera mechanisch bedingt
immer auf Unendlich. Das war absolut genial, da sehr viele Aufnahmen von
Unendlich ausgehend schnell fokussiert werden können. Leider hatte sie keinen Belichtungsmesser eingebaut (das
hatte wohl erst das Modell IIIc (?); ich kaufte mir deshalb einen kleinen
Gossen Sixtino für ca. DM 70.-. Unzählige superscharfe Dias (auf Kodachrome
II, später Kodachrome 25 genannt), der nur 40 ASA (heute: 40 ISO)
Empfindlichkeit hatte, sind damit entstanden (... und durch die Zeitläufte grösstenteils verschwunden... (;-|) ).
 Bild 77: Rolleiflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6cm aus den
1940er Jahren (wegen: "by appointment to his Majesty the King"), gebraucht gekauft um
1972 in London. Optisch sehr gut und angenehm zu bedienen. Allerdings wurden
die Rollfilme langsam immer teurer, und Farbfilme erst recht, so dass nicht mehr
allzu viele Bilder damit entstanden sind.
Bild 77: Rolleiflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6cm aus den
1940er Jahren (wegen: "by appointment to his Majesty the King"), gebraucht gekauft um
1972 in London. Optisch sehr gut und angenehm zu bedienen. Allerdings wurden
die Rollfilme langsam immer teurer, und Farbfilme erst recht, so dass nicht mehr
allzu viele Bilder damit entstanden sind.  allerdings ohne Entfernungsmesser.
Auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich das "Kamera immer dabei" gut
praktizieren konnte, denn sie passte zusammengeklappt sogar in die Hemd-Brusttasche.
allerdings ohne Entfernungsmesser.
Auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich das "Kamera immer dabei" gut
praktizieren konnte, denn sie passte zusammengeklappt sogar in die Hemd-Brusttasche.  Dies war 2004 meine letzte real noch benutzte SLR-"Analog-Kamera", und noch
parallel zu der bereits gekauften Digitalkamera Canon Powershot A200 genutzt.
Ich habe auf Reisen oft mit beiden Kameras dasselbe Motiv photographiert,
besonders bei Landschaftsaufnahmen: Mit der Analog-SLR wegen der Qualität der
Bilder, und mit der A200 wegen des sofortigen Eindrucks.
Dies war 2004 meine letzte real noch benutzte SLR-"Analog-Kamera", und noch
parallel zu der bereits gekauften Digitalkamera Canon Powershot A200 genutzt.
Ich habe auf Reisen oft mit beiden Kameras dasselbe Motiv photographiert,
besonders bei Landschaftsaufnahmen: Mit der Analog-SLR wegen der Qualität der
Bilder, und mit der A200 wegen des sofortigen Eindrucks.
 Meine Meinung:
Wer in der Überfluss-Gesellschaft, mit ihrem exponentiellen Wachstumsdrang und
dem dadurch schnellen "Veralten" ihrer Produkte als Technik-freak mit gewisser
"Verzögerung" mitschwimmt,
indem er eben NICHT immer das Allerneueste haben muss, kann auf der
"Abfallseite" durchaus edle, noch gut brauchbare Teile herausmogeln,
besonders wenn er ein Bastler und Tüftler ist.
Das gilt zwar generell für Schrott, aber eben auch für Edelschrott, und damit für Digitalkameras,
die keineswegs so schnell unbrauchbar werden
wie sie als "veraltet" erscheinen mögen! Auch liegen Kameras bei
manchen Besitzern gerne jahrelang unbenutzt im Schrank. Natürlich gibt es bei realen
Angeboten auch Unterschiede, aber einige sind nach wie vor edle Vertreter ihrer Gattung.
.
Meine Meinung:
Wer in der Überfluss-Gesellschaft, mit ihrem exponentiellen Wachstumsdrang und
dem dadurch schnellen "Veralten" ihrer Produkte als Technik-freak mit gewisser
"Verzögerung" mitschwimmt,
indem er eben NICHT immer das Allerneueste haben muss, kann auf der
"Abfallseite" durchaus edle, noch gut brauchbare Teile herausmogeln,
besonders wenn er ein Bastler und Tüftler ist.
Das gilt zwar generell für Schrott, aber eben auch für Edelschrott, und damit für Digitalkameras,
die keineswegs so schnell unbrauchbar werden
wie sie als "veraltet" erscheinen mögen! Auch liegen Kameras bei
manchen Besitzern gerne jahrelang unbenutzt im Schrank. Natürlich gibt es bei realen
Angeboten auch Unterschiede, aber einige sind nach wie vor edle Vertreter ihrer Gattung.
. Canon PowerShot A200 (Bild 81)
Canon PowerShot A200 (Bild 81)

 Canon PowerShot A470
Bild 84
Canon PowerShot A470
Bild 84
 Bild 85
Bild 85
 Canon PowerShot A 530.
Für unter 10€ gebraucht gekauft. Ist sehr viel einfacher aufgebaut als die unten folgende A570IS. Wird für Experimente benutzt.
Canon PowerShot A 530.
Für unter 10€ gebraucht gekauft. Ist sehr viel einfacher aufgebaut als die unten folgende A570IS. Wird für Experimente benutzt.
 Bild 87
Bild 87
 Bild 88
Bild 88

 Canon Digital IXUS 60
Canon Digital IXUS 60 Canon EOS 20 D
Bild 90
Canon EOS 20 D
Bild 90
 Nach Meinung von Neffe Jens (und mir) die erste akzeptable Canon DSLR, die ich deshalb
auch um 2013 gut erhalten für um 150 € zusammen mit einigen Canon Objektiven gebraucht gekauft habe. Der Fotosensor hat "nur" 8 Megaspixels wie die Powershot Pro 1, aber mit einem wesentlich besserem Rauschverhalten bis 1600 ISO, da der Bildsensor wesentlich grösser ist. Es gibt nur ein optisches Sucherbild, aber keinen "live view". Man fotografiert also noch klassisch, kann das Ergebnis aber nach der Aufnahme im Display begutachten.
Nach Meinung von Neffe Jens (und mir) die erste akzeptable Canon DSLR, die ich deshalb
auch um 2013 gut erhalten für um 150 € zusammen mit einigen Canon Objektiven gebraucht gekauft habe. Der Fotosensor hat "nur" 8 Megaspixels wie die Powershot Pro 1, aber mit einem wesentlich besserem Rauschverhalten bis 1600 ISO, da der Bildsensor wesentlich grösser ist. Es gibt nur ein optisches Sucherbild, aber keinen "live view". Man fotografiert also noch klassisch, kann das Ergebnis aber nach der Aufnahme im Display begutachten.



 Zum Spiegelreflexprinzip generell hier noch ein Erfahrungsbericht:
Zum Spiegelreflexprinzip generell hier noch ein Erfahrungsbericht: Für eine Demo der (bekanntlich ja geringen) Schärfentiefe abhängig von einem ziemlich offenen Blendenwert hatte ich einen Blumenstrauss ausgewählt und, bei Blende F/1.2, laut Sucherbild scharfgestellt (auf das innere der Blüte rechts im Vordergrund).
Für eine Demo der (bekanntlich ja geringen) Schärfentiefe abhängig von einem ziemlich offenen Blendenwert hatte ich einen Blumenstrauss ausgewählt und, bei Blende F/1.2, laut Sucherbild scharfgestellt (auf das innere der Blüte rechts im Vordergrund). 
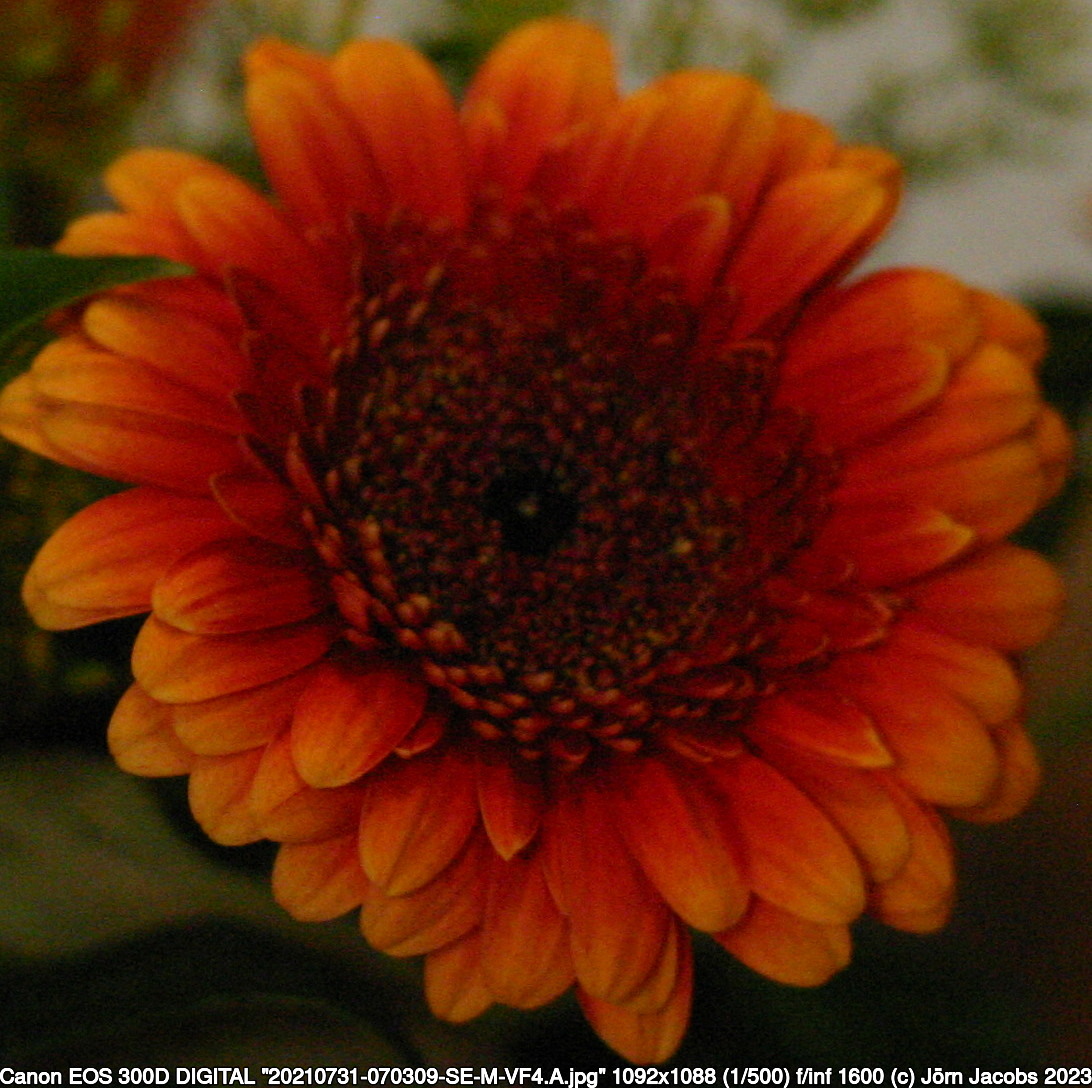
 Ich habe deshalb, das Sucherbild ignorierend, also blind,
"wider besseres Wissen", einige Aufnahmen mit jeweils geringfügig ansteigenden Entfernungseinstellungen gemacht, und siehe da: Gegenüber der ersten Aufnahme, Bild 94, oben
links, zeigt die beste Aufnahme dieser Serie eindeutig einen besseren Schärfeeindruck (siehe das Bild 96, unten links).
Ich habe deshalb, das Sucherbild ignorierend, also blind,
"wider besseres Wissen", einige Aufnahmen mit jeweils geringfügig ansteigenden Entfernungseinstellungen gemacht, und siehe da: Gegenüber der ersten Aufnahme, Bild 94, oben
links, zeigt die beste Aufnahme dieser Serie eindeutig einen besseren Schärfeeindruck (siehe das Bild 96, unten links). 
 Darauf hin habe ich die Aufnahme wiederholt, mit immer noch demselben Objektiv, nun aber mit der live-view-Modus-fähigen Canon EOS 50D
(Bild vom Photosensor wird auf dem Display angezeigt) manuell laut dieser Displayanzeige scharfgestellt.
Das Bild 97,rechts zeigt nun die Blüte im Vordergrund auch sofort mit sehr guter Schärfe.
Das Objektiv ist also nicht der Sündenbock, sondern die SLR-Kameramechanik, die hier mit hineinfunkt.
Ältere DSLRs haben wegen des sonst wohl zu langsamen Autofokus keine andere Wahl, während die "Direktabbildungstechnik"
(also Verwendung des Bildsensors auch schon für die Scharfstellung) alle Probleme elegant umschiffen kann.
Darauf hin habe ich die Aufnahme wiederholt, mit immer noch demselben Objektiv, nun aber mit der live-view-Modus-fähigen Canon EOS 50D
(Bild vom Photosensor wird auf dem Display angezeigt) manuell laut dieser Displayanzeige scharfgestellt.
Das Bild 97,rechts zeigt nun die Blüte im Vordergrund auch sofort mit sehr guter Schärfe.
Das Objektiv ist also nicht der Sündenbock, sondern die SLR-Kameramechanik, die hier mit hineinfunkt.
Ältere DSLRs haben wegen des sonst wohl zu langsamen Autofokus keine andere Wahl, während die "Direktabbildungstechnik"
(also Verwendung des Bildsensors auch schon für die Scharfstellung) alle Probleme elegant umschiffen kann.  -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 Nun noch meine neuesten Kameras:
Nun noch meine neuesten Kameras: Canon EOS M10
Canon EOS M10 Bild 99 und Bild 100: Panasonic Lumix G3,
Bild 99 und Bild 100: Panasonic Lumix G3,


 Beispiel für eine SX40-Freihand-Aufnahme, die sich sehen lassen kann: ISO 160, 1/200 sec, f/5.6, f=150 mm (entspr. 840 mm bei Vollformat), Entfernung ca. 30 m, Bildstabilisator.
Beispiel für eine SX40-Freihand-Aufnahme, die sich sehen lassen kann: ISO 160, 1/200 sec, f/5.6, f=150 mm (entspr. 840 mm bei Vollformat), Entfernung ca. 30 m, Bildstabilisator.
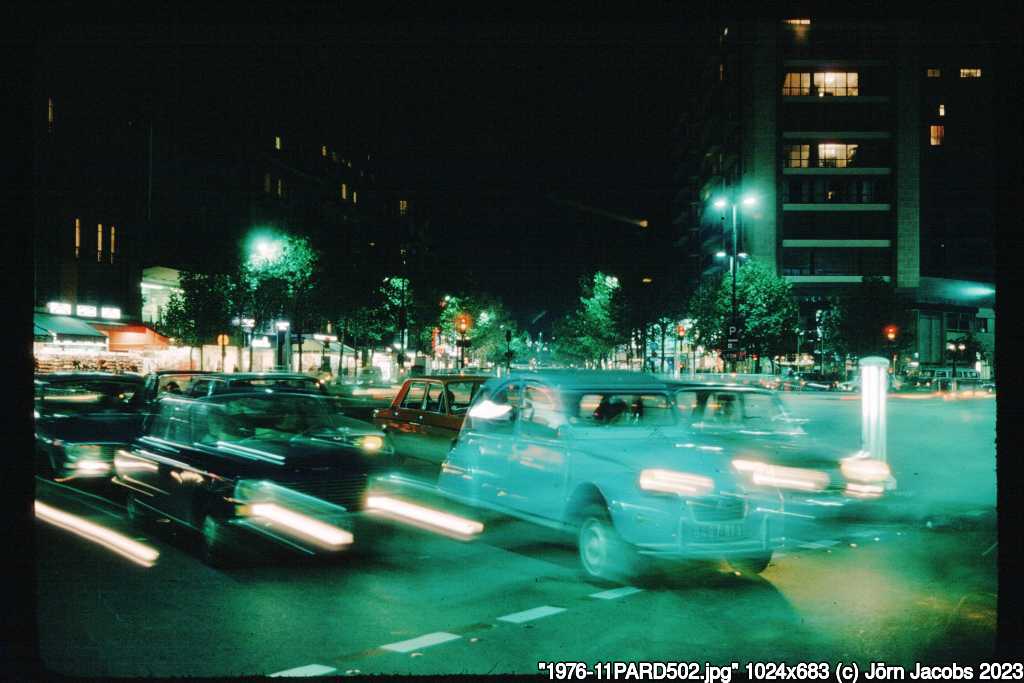
 April 2010, Brunnen in Berlin. Blende F/4.0, 1/400 s
April 2010, Brunnen in Berlin. Blende F/4.0, 1/400 s
 Bilder 106, 107, 108: Flackerndes Feuer, mit 1/500 s aufgenommen, friert die unstete Bewegung ein. Man könnte es fast anfassen, glaubt man.
Bilder 106, 107, 108: Flackerndes Feuer, mit 1/500 s aufgenommen, friert die unstete Bewegung ein. Man könnte es fast anfassen, glaubt man.

 Bild 111
Bild 111
 "Mein Onkel "Wiete", Ingenieur bei den
Hamburger Stadtwerken, im Dienst in der völlig zerbombten Innenstadt. Repro eines Farbdias von 1944.
"Mein Onkel "Wiete", Ingenieur bei den
Hamburger Stadtwerken, im Dienst in der völlig zerbombten Innenstadt. Repro eines Farbdias von 1944.

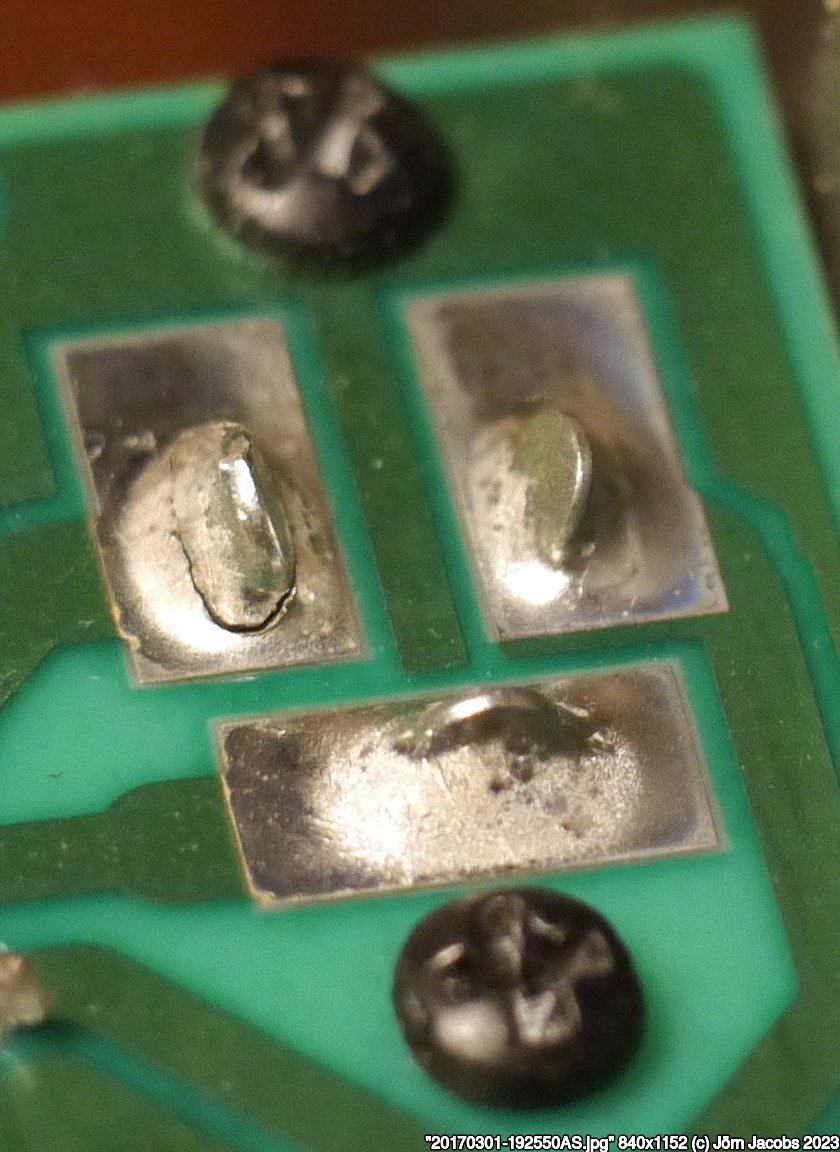 Bild 112 Eine durch Alterung und Eigenerwärmung defekte Lötstelle im Übergang vom Stromversorgungsstecker ("Hohlstecker") auf die Hauptplatine; Betriebsstrom 8 Jahre lang alle paar Tage etwa 700mA; Gerät: Synthesizer-Akkordeon.
Bild 112 Eine durch Alterung und Eigenerwärmung defekte Lötstelle im Übergang vom Stromversorgungsstecker ("Hohlstecker") auf die Hauptplatine; Betriebsstrom 8 Jahre lang alle paar Tage etwa 700mA; Gerät: Synthesizer-Akkordeon.
 Bild 113
Bild 113
 Da hatte jemand vor vielen Jahren die Rolladenkastenverkleidung mit einer gar zu langen Spax-Schraube befestigt. Irgendwann wollte der Laden
dann "
nimmer rolle"!
Da hatte jemand vor vielen Jahren die Rolladenkastenverkleidung mit einer gar zu langen Spax-Schraube befestigt. Irgendwann wollte der Laden
dann "
nimmer rolle"!

 Bild 114
Bild 114
 Illumination in Columbia, S.C. Dez. 2007
Illumination in Columbia, S.C. Dez. 2007
 Bild 115
Bild 115
 Fremdes Helsinki/Helsingfors April 1975
Fremdes Helsinki/Helsingfors April 1975 Wiedergesehenes Kopenhagen 1975
Wiedergesehenes Kopenhagen 1975
 Bild 117
Bild 117
 Paris 1975, Avenue des Champs-Elysees bei Nacht und Regen; die grünliche Färbung ist die Reaktion des Kodachrome-Diafilms auf die damals übliche Strassenbeleuchtung mit Quecksilberdampflampen; heute sind diese damaligen "Stromspar-Lampen" und ihre besondere Spektralverteilung so gut wie verschwunden.
Paris 1975, Avenue des Champs-Elysees bei Nacht und Regen; die grünliche Färbung ist die Reaktion des Kodachrome-Diafilms auf die damals übliche Strassenbeleuchtung mit Quecksilberdampflampen; heute sind diese damaligen "Stromspar-Lampen" und ihre besondere Spektralverteilung so gut wie verschwunden.
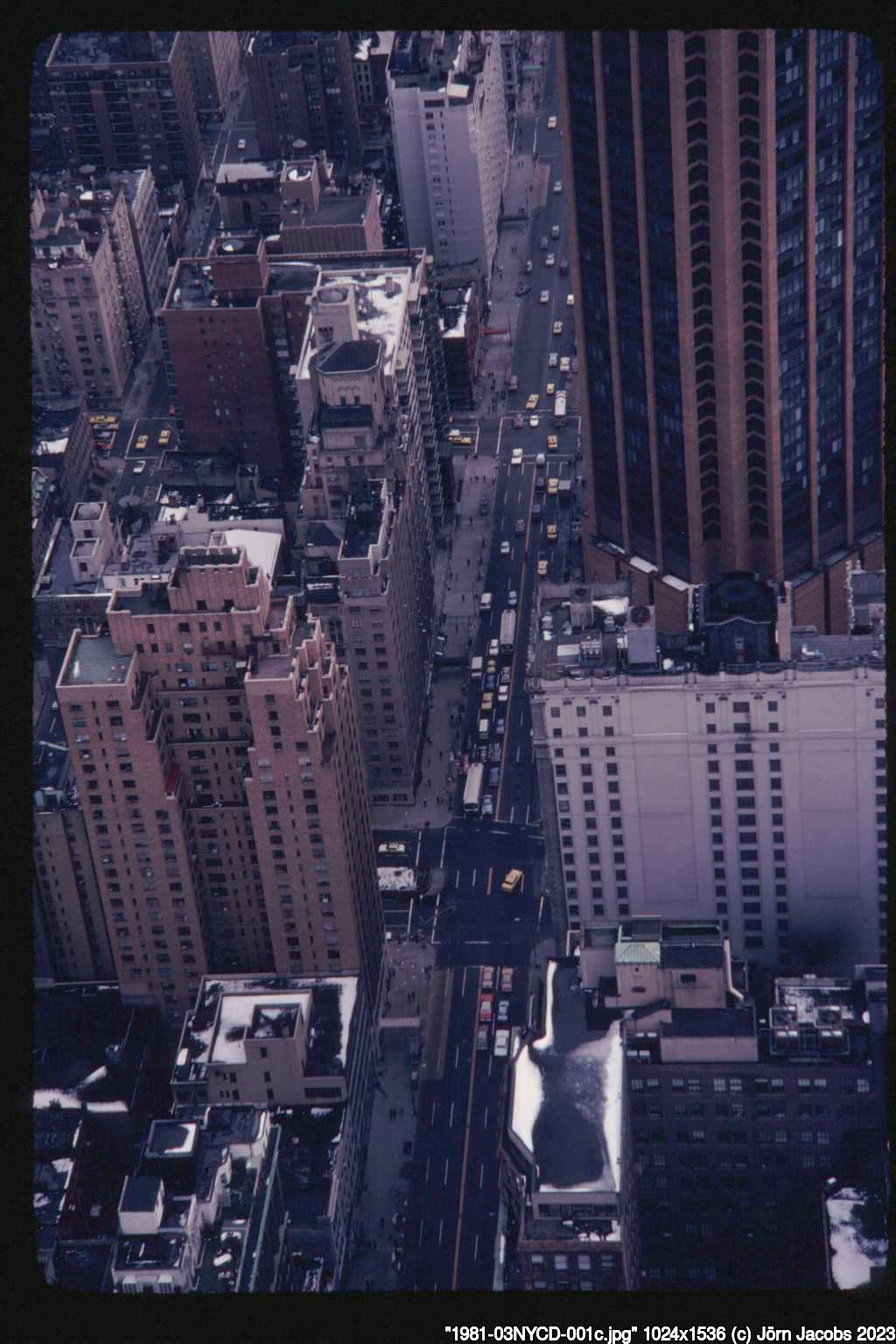
 Bild 119 : Hongkong 1983; alle Bilder dieser Jahre mit Retina IIc und Diafilm
Kodachrome 25 aufgenommen.
Bild 119 : Hongkong 1983; alle Bilder dieser Jahre mit Retina IIc und Diafilm
Kodachrome 25 aufgenommen.
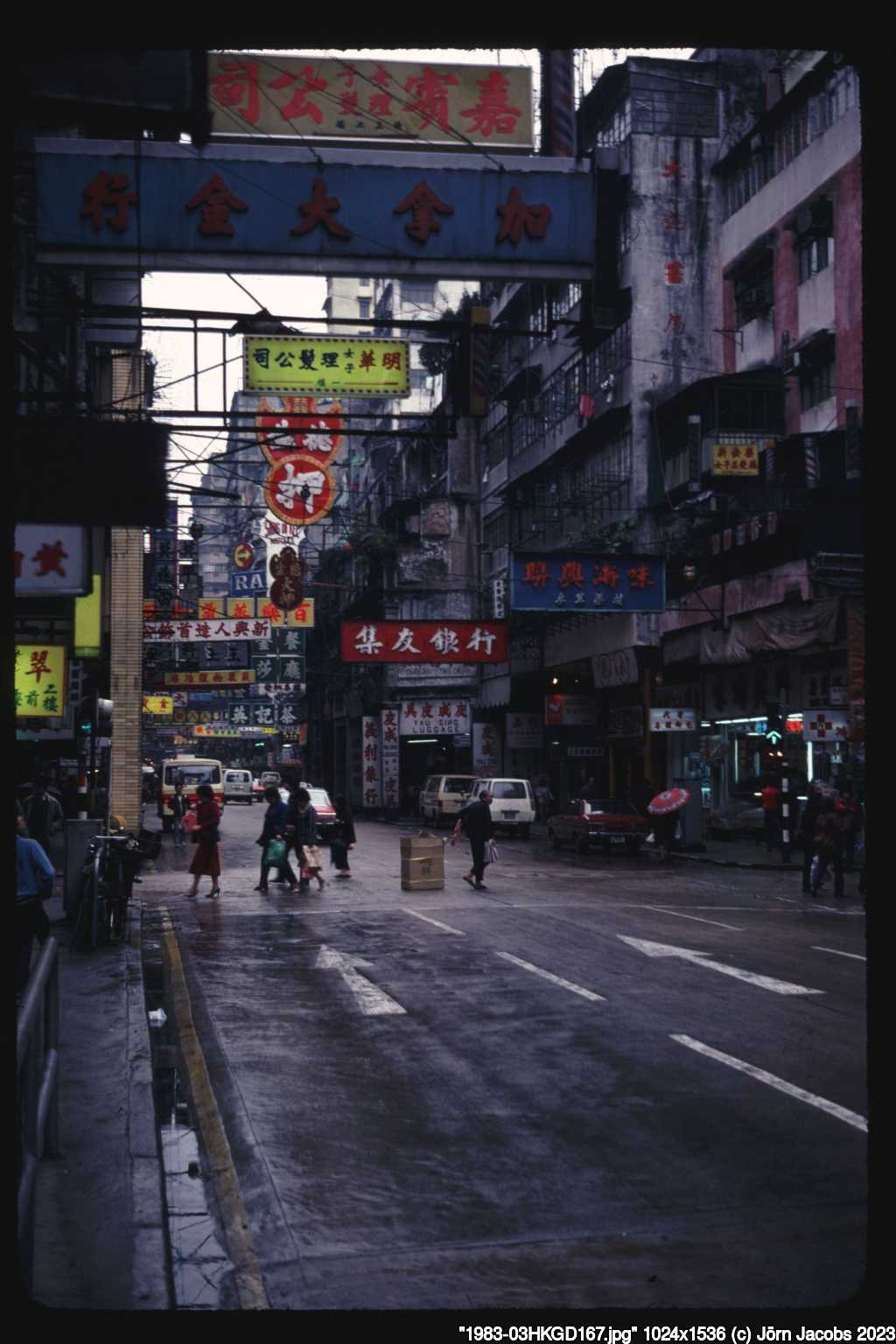
 Bild 120: Tokyo (Shinjuku), 1983
Bild 120: Tokyo (Shinjuku), 1983
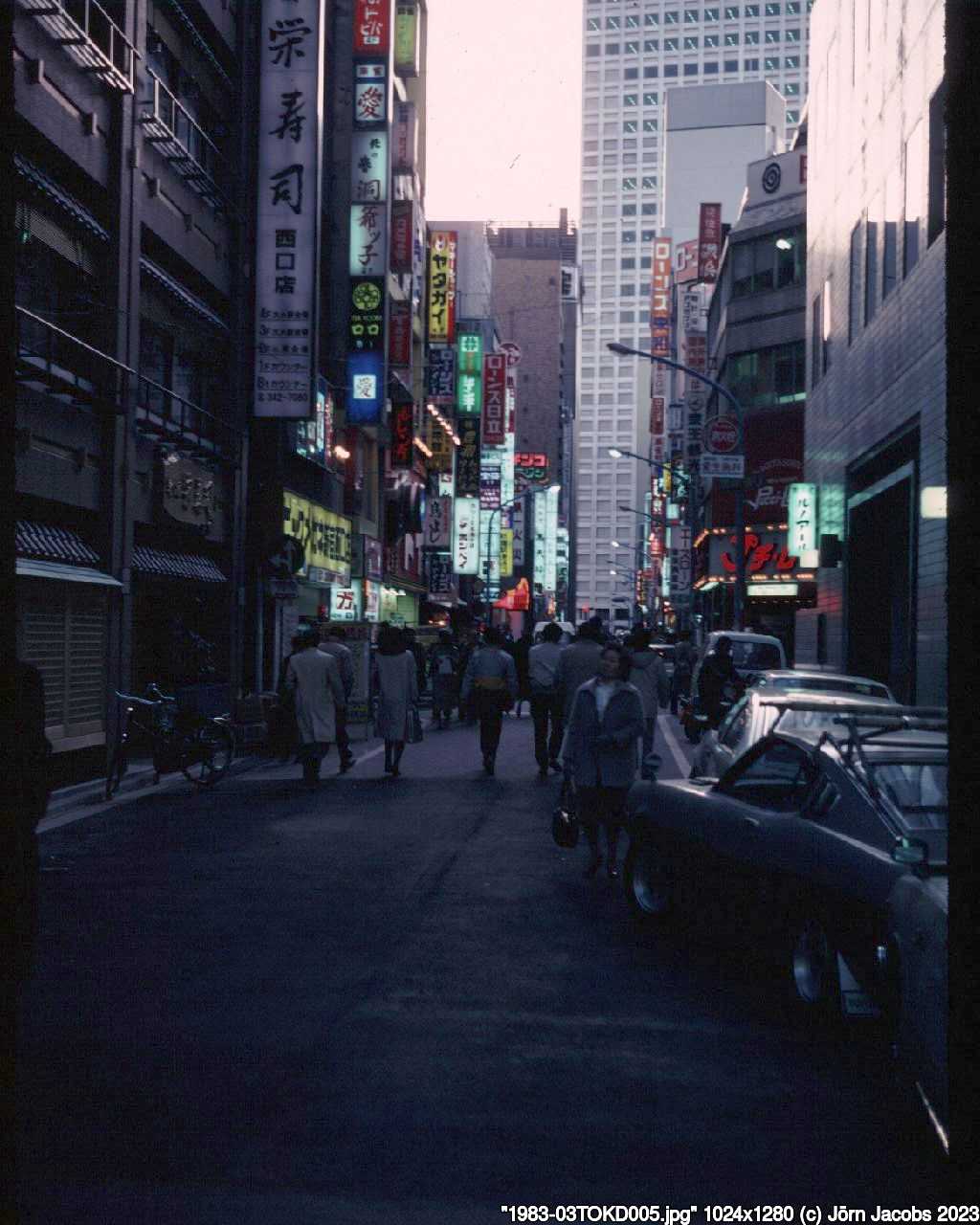

 Bild 121: Tokyo (Shinjuku), mit Bahnschranken aus Bambus. Einige Jahre später gab es an dieser Stelle ein mächtiges Betonviadukt für die Bahn.
Bild 121: Tokyo (Shinjuku), mit Bahnschranken aus Bambus. Einige Jahre später gab es an dieser Stelle ein mächtiges Betonviadukt für die Bahn. 
 Bild 134 zeigt das bekannte Flugzeug Ju 52 in der Museums-Halle Sinsheim, aufgenommen 2007.
Bild 134 zeigt das bekannte Flugzeug Ju 52 in der Museums-Halle Sinsheim, aufgenommen 2007. Erstes Problem: Die Bildwinkelgrösse war durch das Objektiv der Kamera fest vorgegeben. Canon A300: Eingebaute Festbrennweite F/3.6, 5 mm (entspricht 32mm bei 50mm-Objektiven), Bel.-Zeit 0.4 s, Kamera fest aufgesetzt. Ich konnte aber nicht weiter zurückgehen, denn ich
stand auf einem schmalen Besuchersteg, und konnte das Flugzeug also nicht
in voller Breite erfassen. Lösung: Teilaufnahmen gemacht und mit einem
Panorama-Programm zusammengesetzt.
Erstes Problem: Die Bildwinkelgrösse war durch das Objektiv der Kamera fest vorgegeben. Canon A300: Eingebaute Festbrennweite F/3.6, 5 mm (entspricht 32mm bei 50mm-Objektiven), Bel.-Zeit 0.4 s, Kamera fest aufgesetzt. Ich konnte aber nicht weiter zurückgehen, denn ich
stand auf einem schmalen Besuchersteg, und konnte das Flugzeug also nicht
in voller Breite erfassen. Lösung: Teilaufnahmen gemacht und mit einem
Panorama-Programm zusammengesetzt. 
 Das Flugzeug habe ich in mühevoller Kleinarbeit von seinem alten Museums-Hintergrund freigestellt, und dann dem See überlagert.
Das Flugzeug habe ich in mühevoller Kleinarbeit von seinem alten Museums-Hintergrund freigestellt, und dann dem See überlagert.





 Århus 2018: Seefahrtsromantik
Århus 2018: Seefahrtsromantik
 Bild 140
Bild 140
 Paris 1978 (CNET, Issy-les-Moulineaux). Auch steinerne Engel können fliegen!
Paris 1978 (CNET, Issy-les-Moulineaux). Auch steinerne Engel können fliegen!



 Was ist grösser? Edinger Wasserturm versteckt sich hinter einer Pflanze
Was ist grösser? Edinger Wasserturm versteckt sich hinter einer Pflanze
 .
. Bild 146
Bild 146
 Berlin Mitte, 2003. Neptun piekst den Fernmeldeturm am Alexanderplatz.
Berlin Mitte, 2003. Neptun piekst den Fernmeldeturm am Alexanderplatz.

 Bild 147
Bild 147
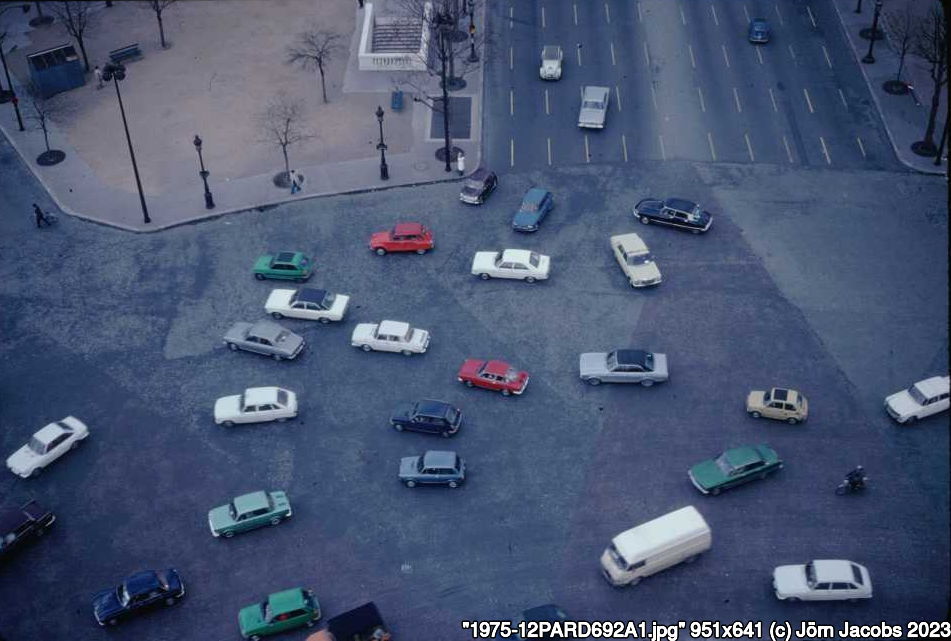 Vom Arc de Triomphe herab das Verkehrsgewühl mit "priorité de droite" (Rechts-vor-Links) auf dem Place d'Étoile: Paris 1975.
Vom Arc de Triomphe herab das Verkehrsgewühl mit "priorité de droite" (Rechts-vor-Links) auf dem Place d'Étoile: Paris 1975.

 Lange Exponate im Museum.
Lange Exponate im Museum.
 Bild 149
Bild 149
 ""Unser Wohnzimmer 2019". 360-Grad-Aufnahme. Ich bin 4-mal abgebildet.
""Unser Wohnzimmer 2019". 360-Grad-Aufnahme. Ich bin 4-mal abgebildet.
 Bastei,2006: Kantige Formen und runde Formen.
Bastei,2006: Kantige Formen und runde Formen.


 Links: Hier scheinen Menschen über das Wasser zu laufen. Die Erklärung hierzu ist das Bild nebenan, Bild 152: Die Stadt Århus hat einen tollen, runden Spazierweg auf dem Meer angelegt, nur wenig höher als der in der Ostsee ja fast konstante Meeresspiegel. Er wird gern beschritten. Eine schöne Idee!
Links: Hier scheinen Menschen über das Wasser zu laufen. Die Erklärung hierzu ist das Bild nebenan, Bild 152: Die Stadt Århus hat einen tollen, runden Spazierweg auf dem Meer angelegt, nur wenig höher als der in der Ostsee ja fast konstante Meeresspiegel. Er wird gern beschritten. Eine schöne Idee!

 Washington, D.C. April 2006, Laus auf Appartmenthaus-Balkongeländer, im 6.Stock.
Washington, D.C. April 2006, Laus auf Appartmenthaus-Balkongeländer, im 6.Stock.
 Bild 154
Bild 154
 Barcelona 2007. Blick morgens vom Hotelfenster im 6.Stock auf die Strasse.
Bild 155
Barcelona 2007. Blick morgens vom Hotelfenster im 6.Stock auf die Strasse.
Bild 155

 Der "kleine" Frankfurter Hauptbahnhof, 2006, aus einer Bank-Hochhaus-Perspektive.
Der "kleine" Frankfurter Hauptbahnhof, 2006, aus einer Bank-Hochhaus-Perspektive. Bild 156
Bild 156
 Kolpingstrasse, Edingen, 2018 und 2021, aus der Perspektive unserer beiden Hunde
Kolpingstrasse, Edingen, 2018 und 2021, aus der Perspektive unserer beiden Hunde Bild 157
Bild 157
 und einer Laus:
und einer Laus:
 Bild 158
Bild 158
 sowie eines tieffliegenden Insekts.
sowie eines tieffliegenden Insekts.


 Bild 159: Eine ganz tolle Perspektiven-Idee in Århus, 2018: Dieser als ein Farbverlauf
verglaste Rundgang mit Blick über die Stadt und die jütländische Landschaft,
Bild 160,
Bild 159: Eine ganz tolle Perspektiven-Idee in Århus, 2018: Dieser als ein Farbverlauf
verglaste Rundgang mit Blick über die Stadt und die jütländische Landschaft,
Bild 160,
 ermöglicht es, die "Welt" in ganz verschiedenen Färbungen zu betrachten: Die
jeweils sich einstellende Stimmung ändert sich alle paar Schritte! Zum Aufbau siehe das kleine Bild unten:
ermöglicht es, die "Welt" in ganz verschiedenen Färbungen zu betrachten: Die
jeweils sich einstellende Stimmung ändert sich alle paar Schritte! Zum Aufbau siehe das kleine Bild unten:

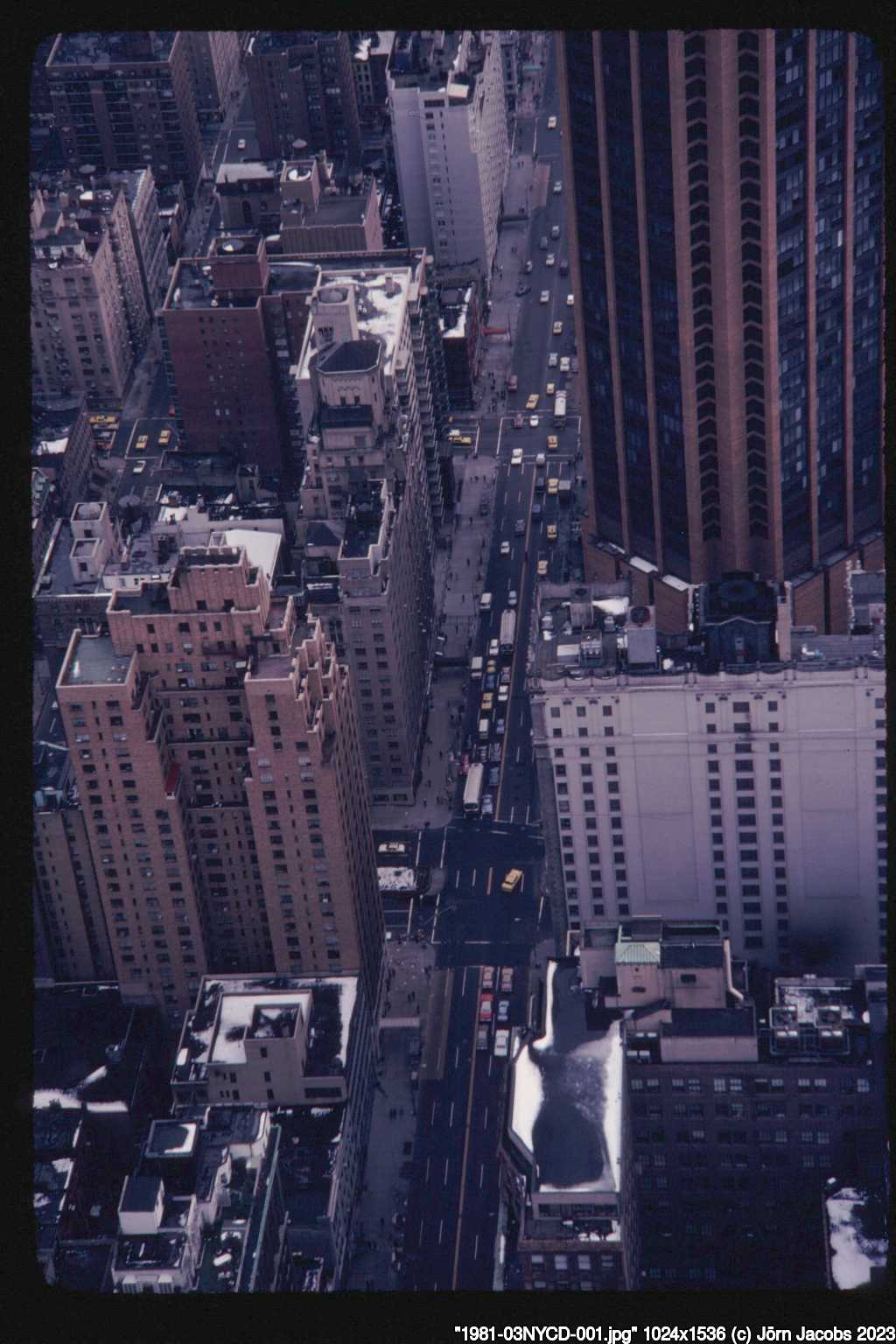
 Wie sich die Bilder entsprechen! Links: Manhattan,N.Y., 1981 real, aufrecht, und
rechtes Bild: An der Decke hängende Metall-Plastik, Århus,Gebäude DOKK1, 2018.
Wie sich die Bilder entsprechen! Links: Manhattan,N.Y., 1981 real, aufrecht, und
rechtes Bild: An der Decke hängende Metall-Plastik, Århus,Gebäude DOKK1, 2018.

 Rheinstrasse Darmstadt, 2010. Die Entfernung vom Standort bis zum Schloss am Ende der Strasse ist mehr als 1 km!
Rheinstrasse Darmstadt, 2010. Die Entfernung vom Standort bis zum Schloss am Ende der Strasse ist mehr als 1 km!
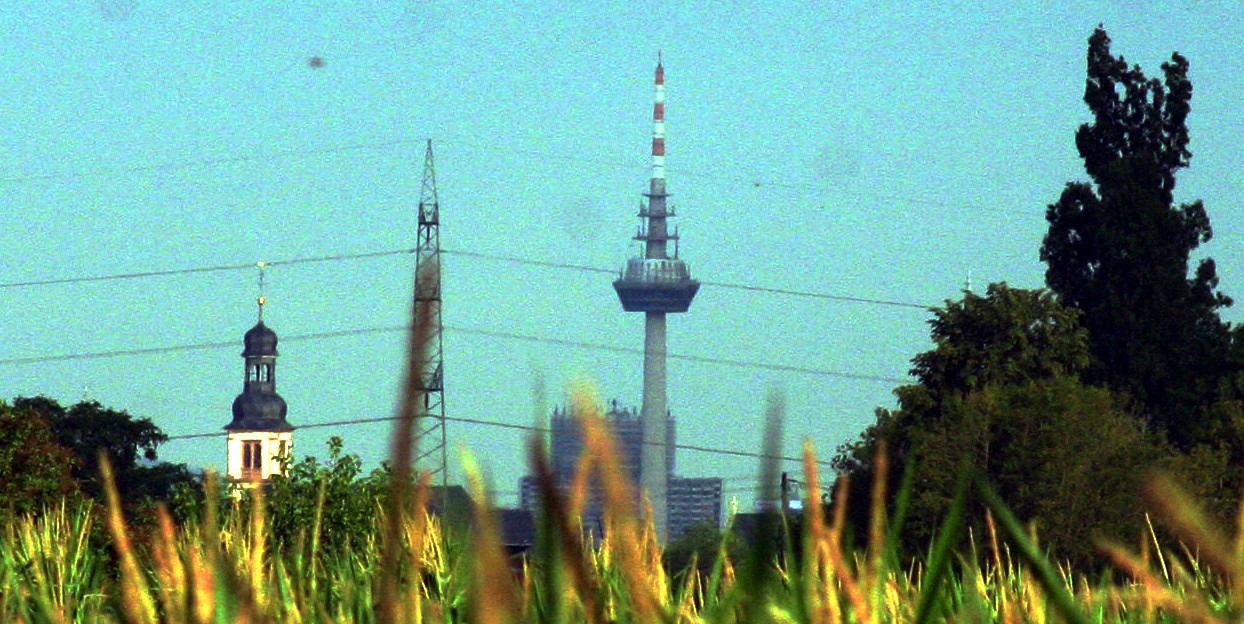 Von Edingen, nähe neuer Sportplatz, mit starkem Tele aufgenommen: Kamera: Canon EOS300D, 1/1000 s, F/13, 200mm (35mm: 320mm), ISO 800, Ausschnitt.
Von Edingen, nähe neuer Sportplatz, mit starkem Tele aufgenommen: Kamera: Canon EOS300D, 1/1000 s, F/13, 200mm (35mm: 320mm), ISO 800, Ausschnitt. 



 Bild 168
Bild 168
 Sicherlich ein schönes Foto...
Sicherlich ein schönes Foto... Es sei denn, man geht sehr weit weg und verzichtet auf die Details.
Das ist hier sicherlich angebracht: Blumen-Tier in Bilbao, 2010. Na gut, dies hier
ist ein unpassendes Extrem-Gegenbeispiel (;-).
Es sei denn, man geht sehr weit weg und verzichtet auf die Details.
Das ist hier sicherlich angebracht: Blumen-Tier in Bilbao, 2010. Na gut, dies hier
ist ein unpassendes Extrem-Gegenbeispiel (;-).






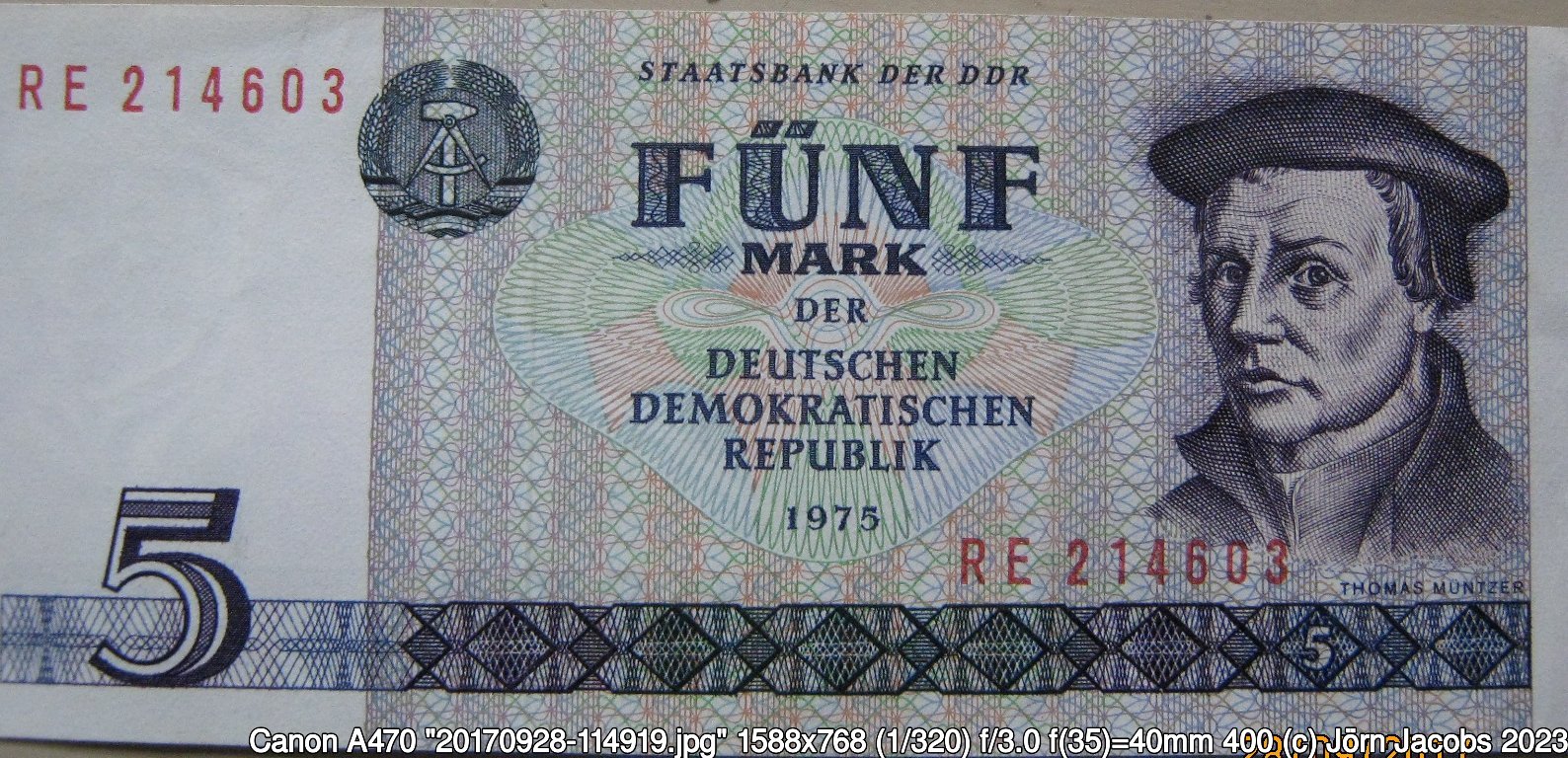


 Breslau (Wrocław). Teilansicht des Denkmals über den Bevölkerungswechsel nach 1945.
Breslau (Wrocław). Teilansicht des Denkmals über den Bevölkerungswechsel nach 1945.

 Bild 231:Grosse Moschee in Dubai, 2008. Die Wüste geht bis ans Meer,
deshalb Bewölkung. Aber es regnet nur äusserst selten.
Bild 231:Grosse Moschee in Dubai, 2008. Die Wüste geht bis ans Meer,
deshalb Bewölkung. Aber es regnet nur äusserst selten.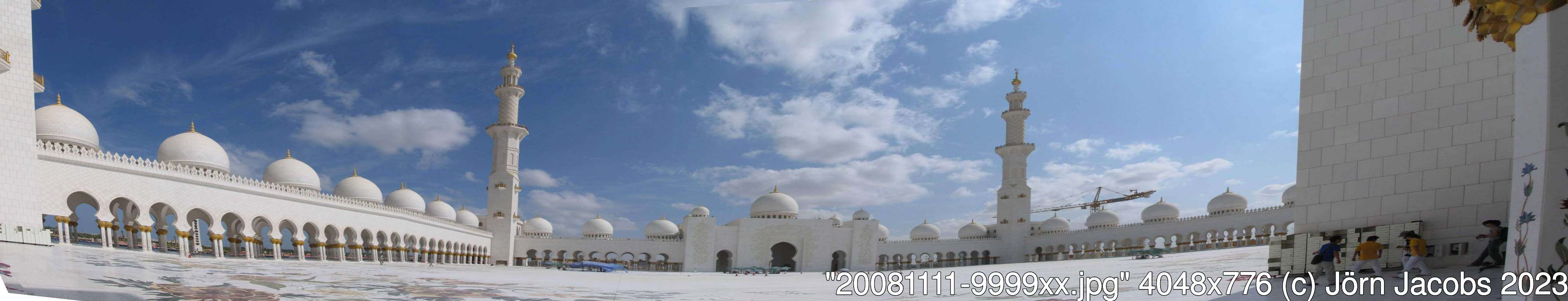 Bild 232: Grand Canyon, 2004
Bild 232: Grand Canyon, 2004 Bild 235
Bild 235
 Bild 236
Bild 236
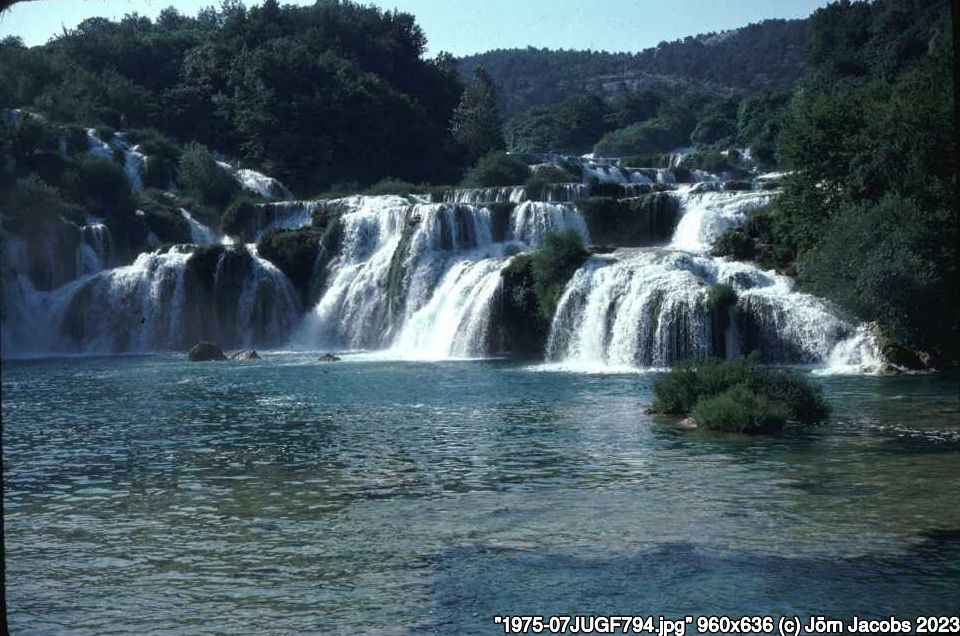 Krka-Wasserfälle, Jugoslawien 1975
Krka-Wasserfälle, Jugoslawien 1975 Bild 237 und Bild 238: Niagara Falls, 2010
Bild 237 und Bild 238: Niagara Falls, 2010


 Bild 239: Einer der mud pools von Rotorua, New Zealand, gefüllt mit heissem, blubberndem, vulkanischen Matsch. Aug. 2002.
Bild 239: Einer der mud pools von Rotorua, New Zealand, gefüllt mit heissem, blubberndem, vulkanischen Matsch. Aug. 2002. Bild 240
Bild 240
 Bild 241: Schon mal irgendwo gesehen? ....Richtig! Das Titelblatt !: Der Neckar bei Edingen/Baden
Bild 241: Schon mal irgendwo gesehen? ....Richtig! Das Titelblatt !: Der Neckar bei Edingen/Baden

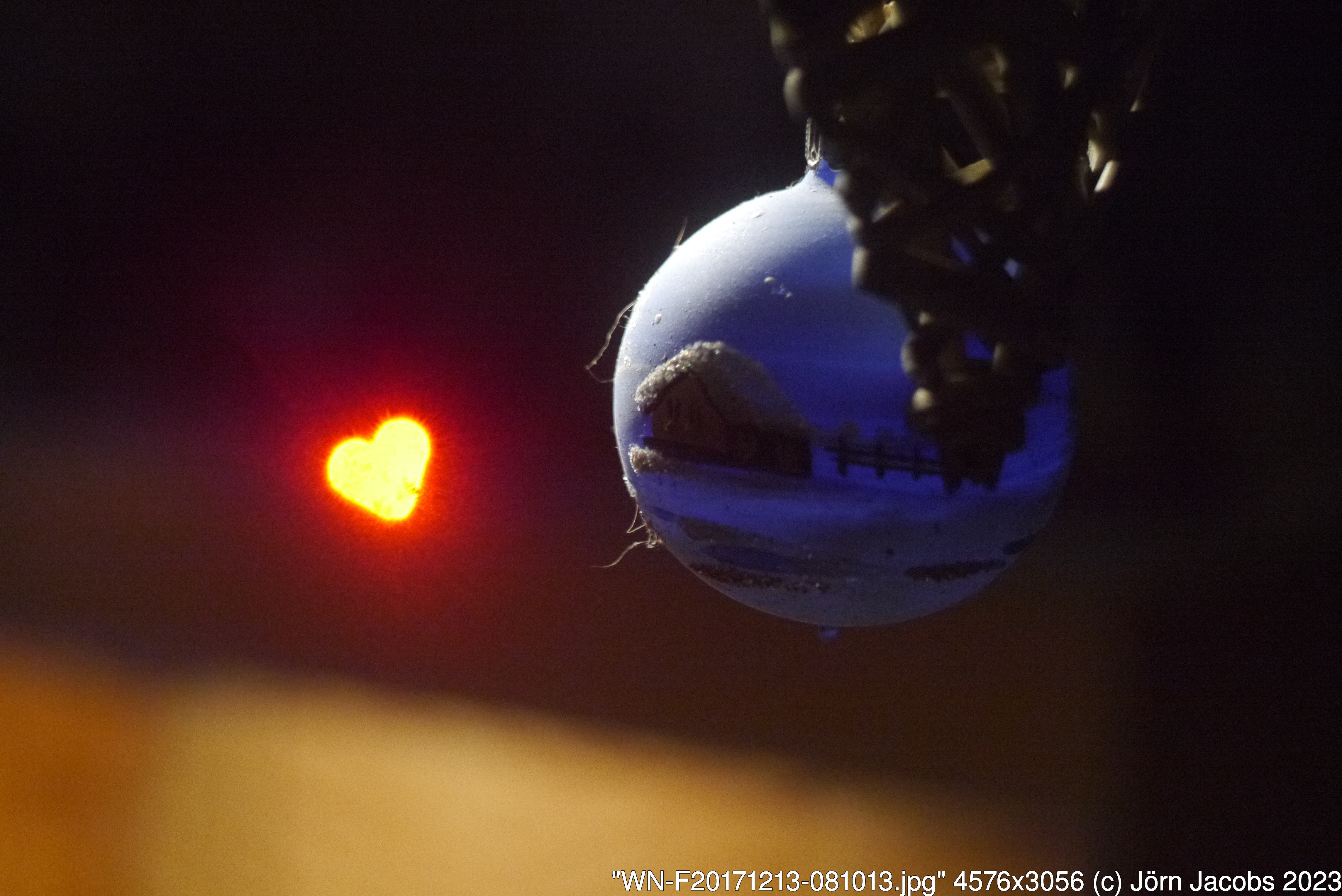


 Den ""
irdischen" Bereich habe ich etwas aufgehellt,da dieser Teil unterbelichtet war. Aber man kann an einer gemachten Aufnahme in so einem Fall nicht so sehr viel ändern.
Den ""
irdischen" Bereich habe ich etwas aufgehellt,da dieser Teil unterbelichtet war. Aber man kann an einer gemachten Aufnahme in so einem Fall nicht so sehr viel ändern. Bild 250: 18.11.2020: Was ist los im Grenzhöfer-/ Friedrichsfelder Wald?
Bild 250: 18.11.2020: Was ist los im Grenzhöfer-/ Friedrichsfelder Wald?

 Bild 251: 01.08.2018: Doppelter Regenbogen über Edingen.
Bild 251: 01.08.2018: Doppelter Regenbogen über Edingen.

 Bild 252: 22.03.2019, 08:54 Uhr: Kondens-Streifen über Edingen. Sie geben einen Eindruck
von der
Dichte des Flugverkehrs. Glücklicherweise sind das alles "Überflieger", die man
wegen der grossen Höhe = Entfernung von meist mehr als 7000 m im "Ländle" nicht
mehr hören kann.
Bild 252: 22.03.2019, 08:54 Uhr: Kondens-Streifen über Edingen. Sie geben einen Eindruck
von der
Dichte des Flugverkehrs. Glücklicherweise sind das alles "Überflieger", die man
wegen der grossen Höhe = Entfernung von meist mehr als 7000 m im "Ländle" nicht
mehr hören kann.

 Bild 253: Sonnenstrahlen bilden einen Trichter
Bild 253: Sonnenstrahlen bilden einen Trichter
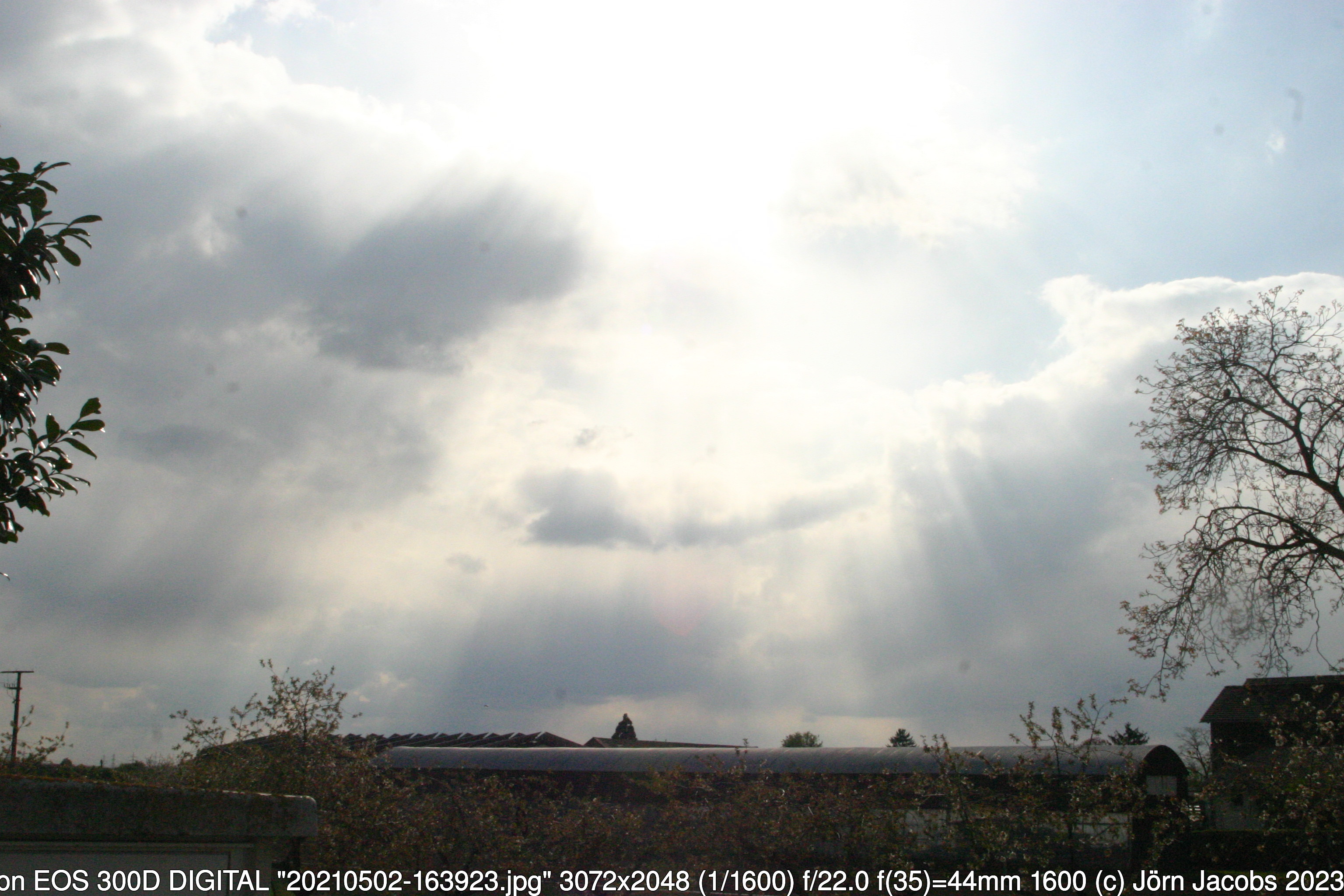
 Bild 254 Sonnenuntergang in Edingen,
Bild 254 Sonnenuntergang in Edingen,

 Bild 255: Wolken, vom Sonnenuntergang erhellt
Bild 255: Wolken, vom Sonnenuntergang erhellt

 Bild 256: Himmelszeichen: Wer ist gemeint?
Bild 256: Himmelszeichen: Wer ist gemeint?  Bild 257: Was ist da los?
Bild 257: Was ist da los?

 ""Sonnen-Laterne", eigentlich ein Schattenspender...
""Sonnen-Laterne", eigentlich ein Schattenspender...

 Bild 259 Wolkenloch über Mannheim- Neckarstadt
Bild 259 Wolkenloch über Mannheim- Neckarstadt

 Bild 260 Drohende Bewölkung über Edingen
Bild 260 Drohende Bewölkung über Edingen


 Frankfurt 11.2008: Vom 16. Stock aus der Blick von Sachsenhausen in Richtung Taunus, und
Bild 262
Frankfurt 11.2008: Vom 16. Stock aus der Blick von Sachsenhausen in Richtung Taunus, und
Bild 262
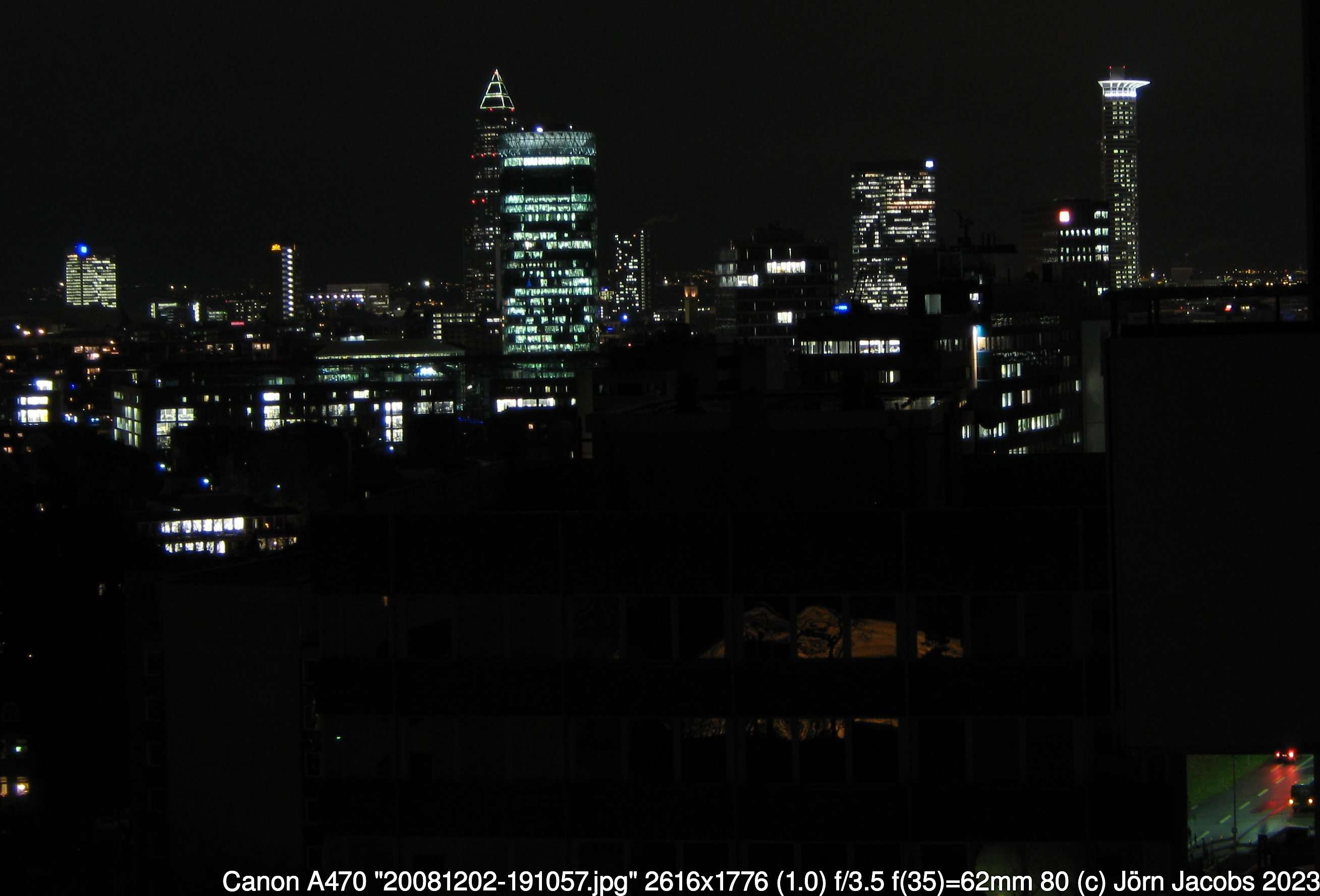 Frankfurt 12.2008: Derselbe Blick bei Nacht (Sachsenhausen -> Taunus)
Frankfurt 12.2008: Derselbe Blick bei Nacht (Sachsenhausen -> Taunus)






 Bild 267, Bild 268: Grenå 2015
Bild 267, Bild 268: Grenå 2015

 Sturm an der jütländischen Ostküste, Sept. 2015.
Sturm an der jütländischen Ostküste, Sept. 2015.
 Bild 269: Wolkenlandschaft: Täuschend ruhig, aber in Wirklichkeit voller Bewegung. Blick aus dem Flugzeugfenster, erstmals gesehen und fotografiert irgendwo zwischen Frankfurt/M und Wien, 1975.
Bild 269: Wolkenlandschaft: Täuschend ruhig, aber in Wirklichkeit voller Bewegung. Blick aus dem Flugzeugfenster, erstmals gesehen und fotografiert irgendwo zwischen Frankfurt/M und Wien, 1975.



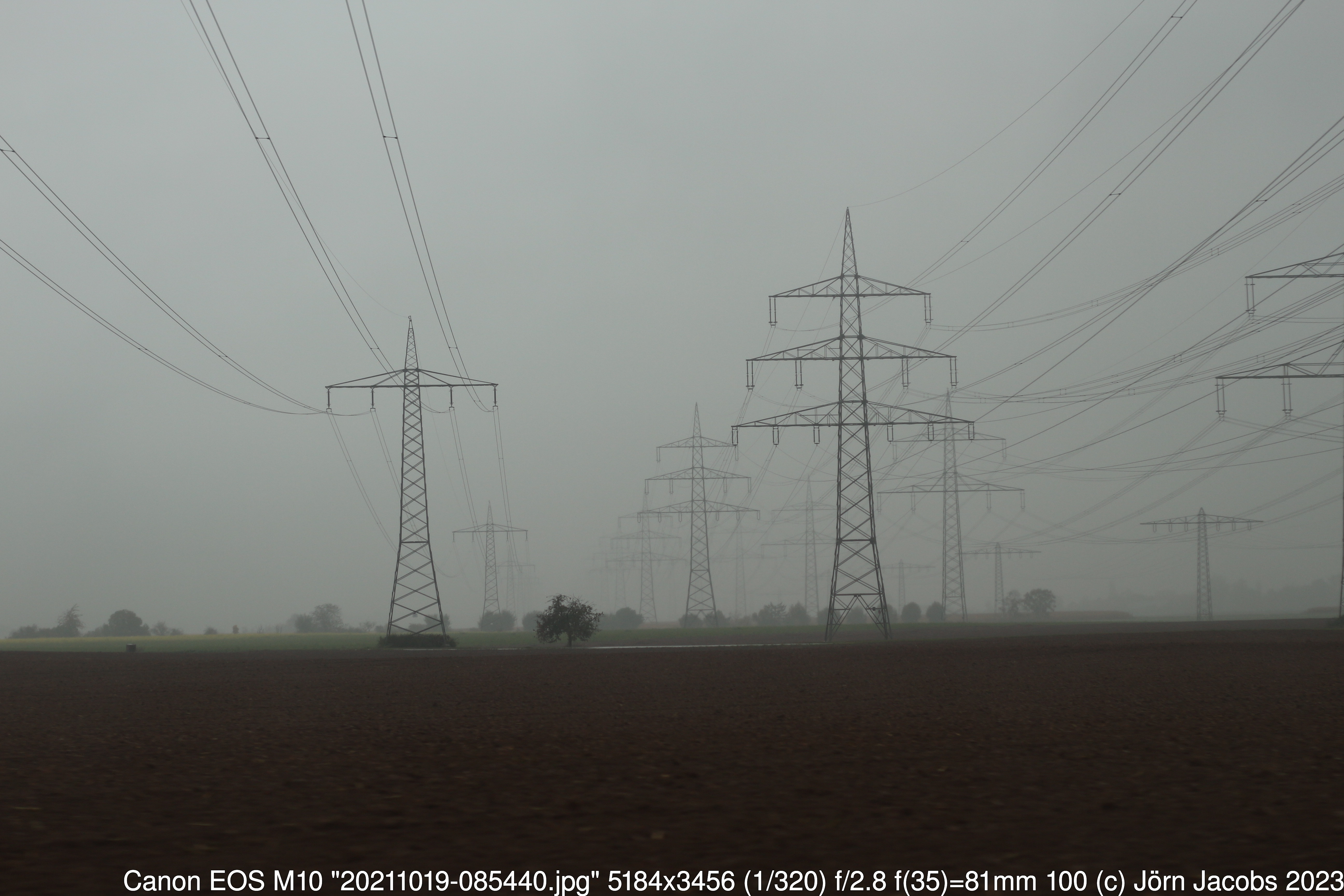


 Diese Aufnahme ist mit einer "Handy"-Kamera gelungen: Das Rheintal bei Edingen, 2016. Die starke räumliche Wirkung der Baumreihe und die
günstigen Lichtverhältnisse mit halbem, abgeschirmten
Gegenlicht lassen kaum etwas vermissen.
Das Bild war lange Zeit mein "Bildschirmschoner".
Diese Aufnahme ist mit einer "Handy"-Kamera gelungen: Das Rheintal bei Edingen, 2016. Die starke räumliche Wirkung der Baumreihe und die
günstigen Lichtverhältnisse mit halbem, abgeschirmten
Gegenlicht lassen kaum etwas vermissen.
Das Bild war lange Zeit mein "Bildschirmschoner".
 <
<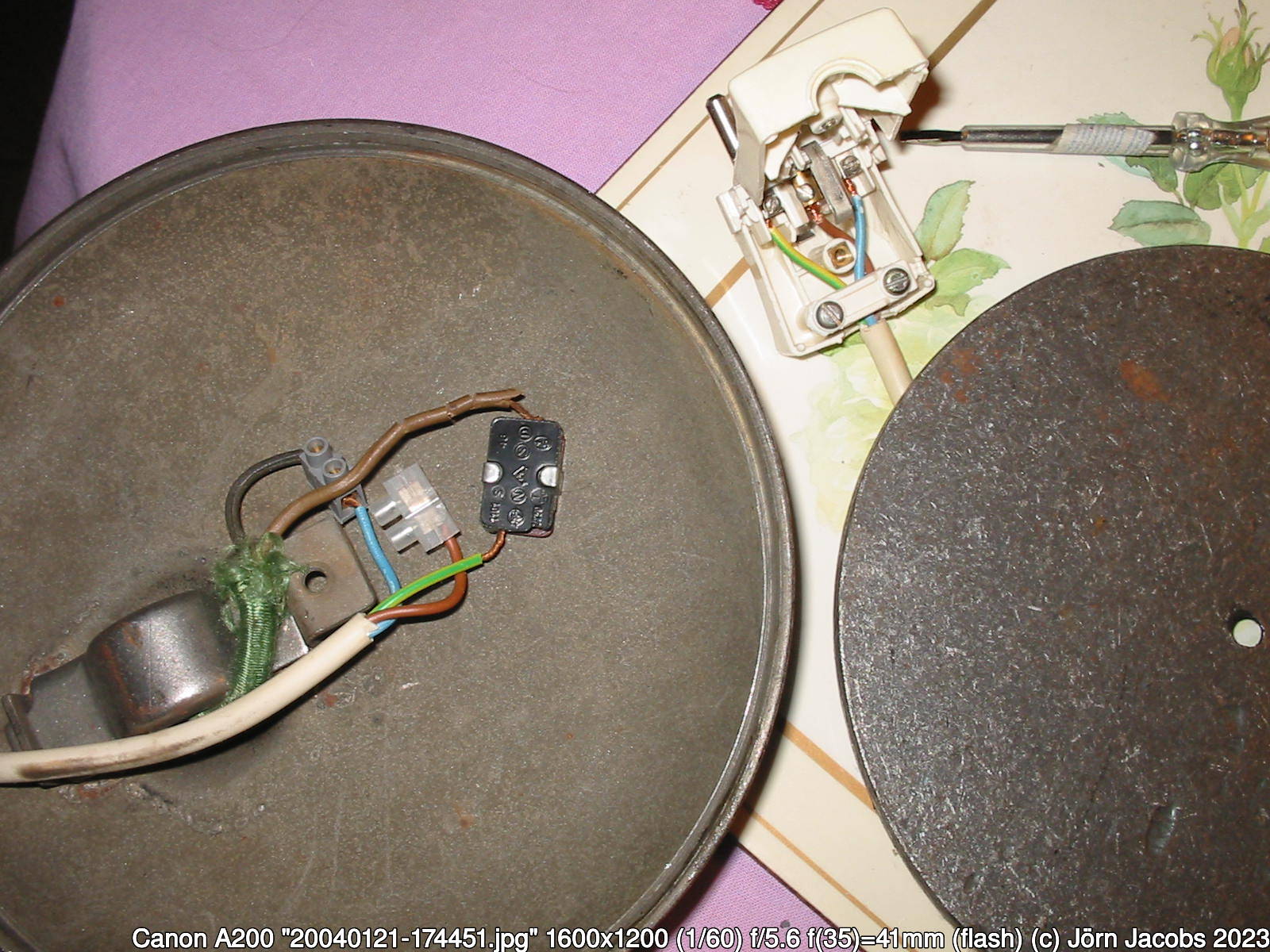 as late as 2004: Eine völlig falsch angeschlossene Tischlampe. Das musste ich als E-Techniker dann doch fotografieren!
as late as 2004: Eine völlig falsch angeschlossene Tischlampe. Das musste ich als E-Techniker dann doch fotografieren!

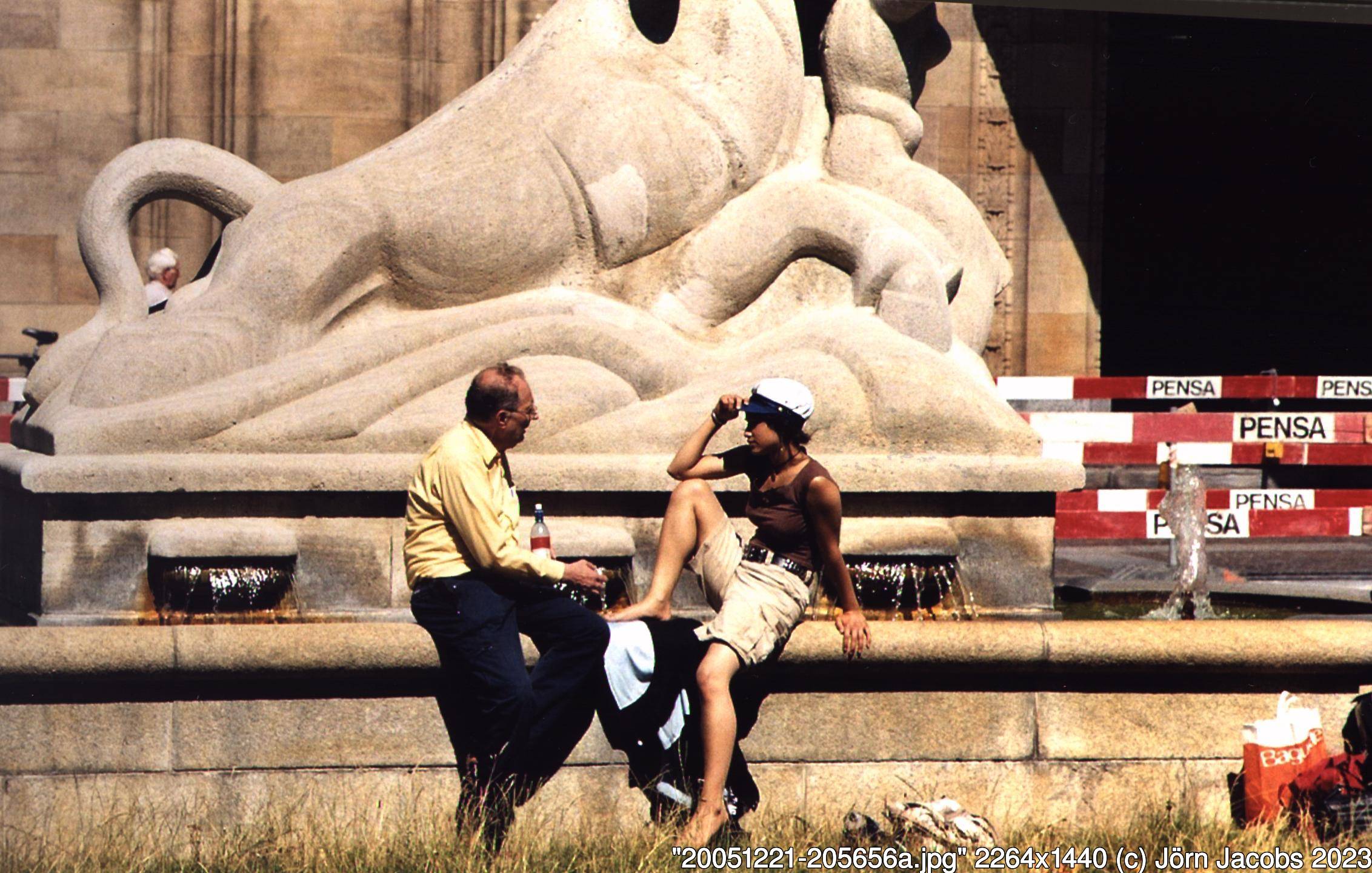 Im Vorbeifahren aus dem Reisebus am Hauptbahnhof von Zürich geknipst. Über
dieses Bild kann man stundenlang nachdenken (Aufforderung
"pensa!"), und wird doch nie
herausfinden können, welche Situation hier vorlag. Dezember 2005.
Im Vorbeifahren aus dem Reisebus am Hauptbahnhof von Zürich geknipst. Über
dieses Bild kann man stundenlang nachdenken (Aufforderung
"pensa!"), und wird doch nie
herausfinden können, welche Situation hier vorlag. Dezember 2005. Dubai, 11.2008, Baustelle am Strand bei Hotel Jumeirah. Kamera auf
einen Stein gepresst, und Auslöser gedrückt. .ISO 100, 1 s, f/3.2
Dubai, 11.2008, Baustelle am Strand bei Hotel Jumeirah. Kamera auf
einen Stein gepresst, und Auslöser gedrückt. .ISO 100, 1 s, f/3.2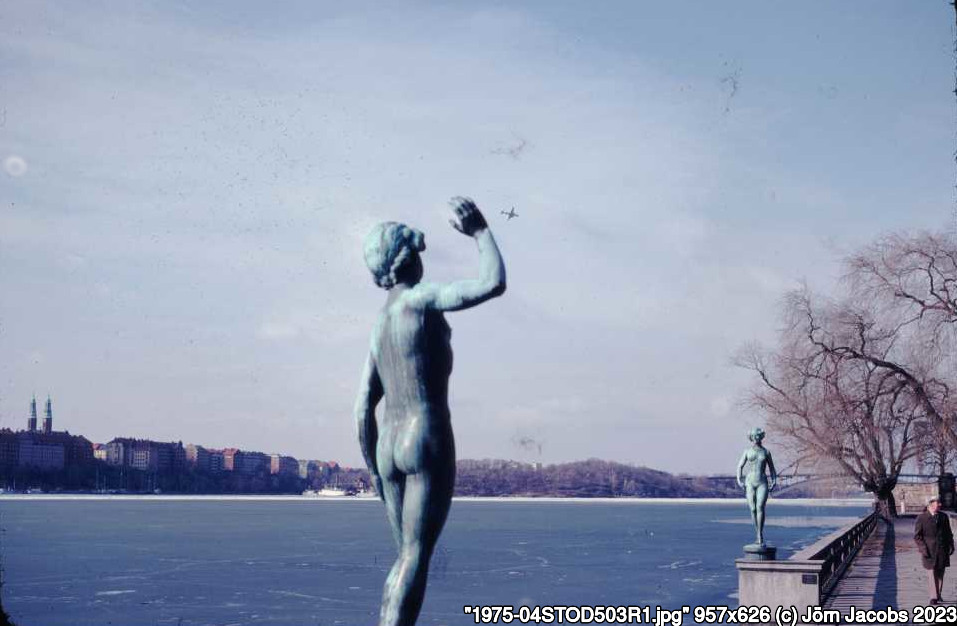 Nixe wirft Flugzeug (Stockholm, 1975)
Nixe wirft Flugzeug (Stockholm, 1975) Bild 276
Bild 276
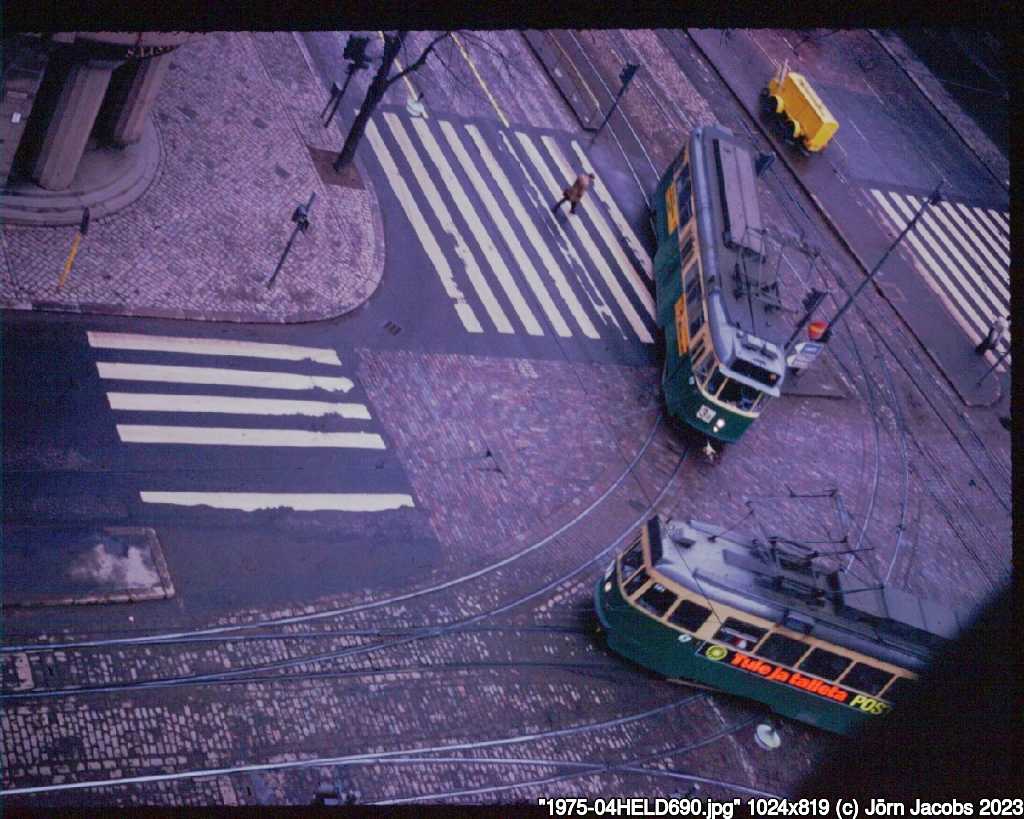 Wer hat Vorfahrt? Helsinki, April 1974.
Wer hat Vorfahrt? Helsinki, April 1974.
 Die Ahr hat Hochwasser, Sept. 2007.
Bild 278
Die Ahr hat Hochwasser, Sept. 2007.
Bild 278





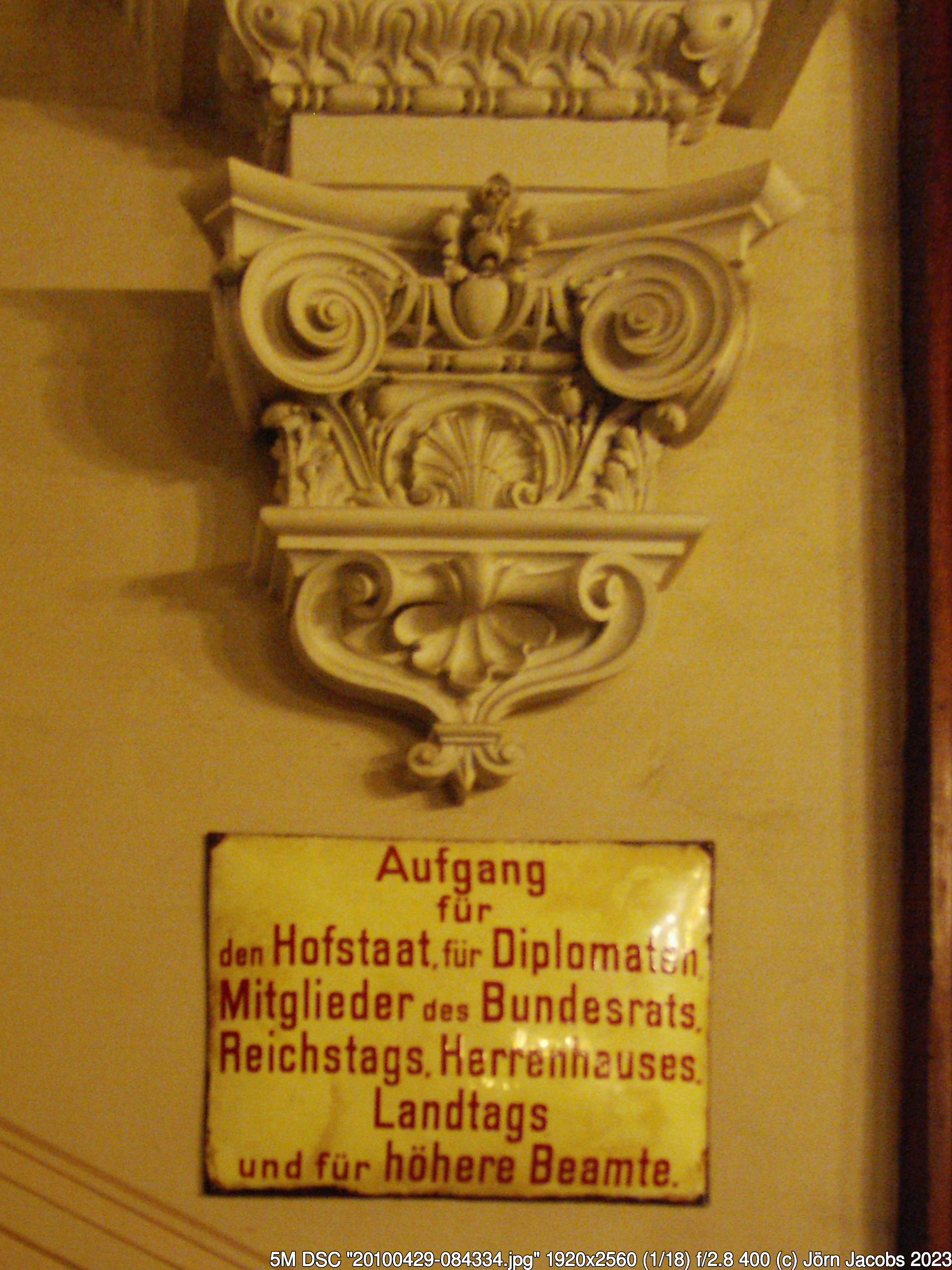 Bild 283: Altes Schild im Berliner Dom.
Bild 283: Altes Schild im Berliner Dom.




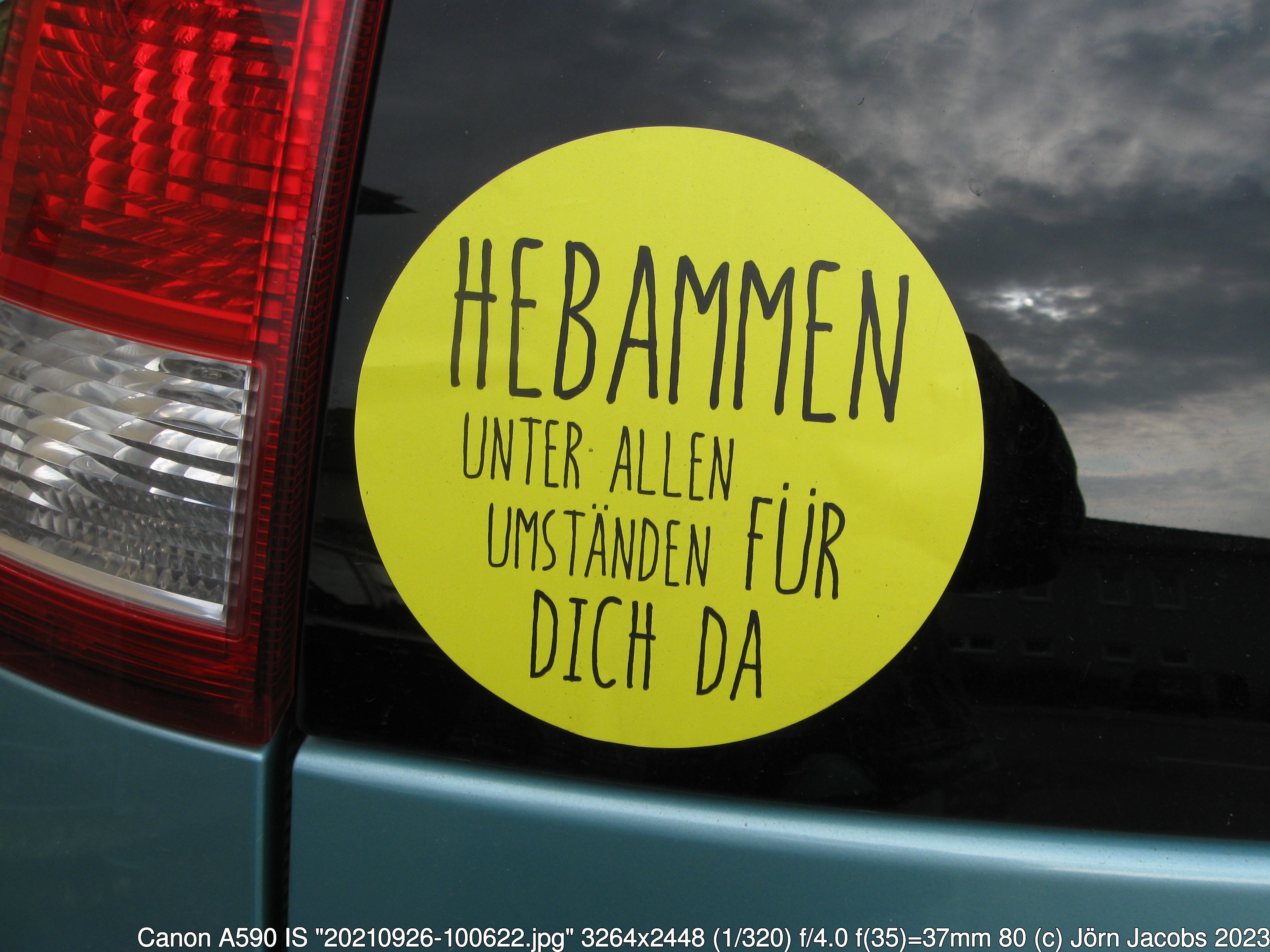


 Bild 313
Bild 313
 Bild 314
Bild 314
 Bild 315
Bild 315
 Bild 316
Bild 316
 Bild 317
Bild 317
 Bild 318
Bild 318
 Bild 319
Bild 319
 Bild 320
Bild 320
 Bild 321
Bild 321
 Bild 322
Bild 322
 Bild 323
Bild 323
 Bild 324
Bild 324
 Bild 325
Bild 325
 Bild 326
Bild 326


 Bild 362A
Bild 362A
 Eine fast perfekte Verdoppelung gelang hier durch Spiegelung an einer Trennscheibe zwischen WC und Dusche
Eine fast perfekte Verdoppelung gelang hier durch Spiegelung an einer Trennscheibe zwischen WC und Dusche




 Bild 329
Bild 329

 Bild 331
Bild 331
 Århus, 2018
Århus, 2018 Bild 332
Bild 332
 Darmstadt 2008: Spiegelung des Alten Theaters (alias "Hessisches Staatsarchiv") im ""neuen", tatsächlich so schrägwandig gebauten TU-Portal.
Darmstadt 2008: Spiegelung des Alten Theaters (alias "Hessisches Staatsarchiv") im ""neuen", tatsächlich so schrägwandig gebauten TU-Portal. Bild 333
Bild 333
 Washington, D.C. Airport, 2006. Ob der Fussboden heut wohl noch so blank ist?
Washington, D.C. Airport, 2006. Ob der Fussboden heut wohl noch so blank ist? Bild 334
Bild 334

 Luzern, Winter 2008
Luzern, Winter 2008 Edingen, 2019: Nach einem Wolkenbruch...
Edingen, 2019: Nach einem Wolkenbruch...
 Bild 336
Bild 336
 Studie zu einer kombinierten Weihnachts-Oster-Karte.
Studie zu einer kombinierten Weihnachts-Oster-Karte. Bild 337
Bild 337
 Esszimmer am Nachmittag (mit fisheye-Objektiv). Spiegelung durch eine Plastik-Tischdecke.
Esszimmer am Nachmittag (mit fisheye-Objektiv). Spiegelung durch eine Plastik-Tischdecke. Bild 338 Lichterschau im Luisenpark, Mannheim, März 2020. Unerwartet schön ist auch die
Reflex-Wirkung auf dem feuchten Boden im zweiten Bild. Man könnte dieses Bild natürlich auch noch entzerren/begradigen. Dann sieht es aber deutlich langweiliger aus.
Bild 338 Lichterschau im Luisenpark, Mannheim, März 2020. Unerwartet schön ist auch die
Reflex-Wirkung auf dem feuchten Boden im zweiten Bild. Man könnte dieses Bild natürlich auch noch entzerren/begradigen. Dann sieht es aber deutlich langweiliger aus.

 Bild 339
Bild 339

 Bild 340
Bild 340
 In Memoriam Joy Fleming: Plakat mit einer Spiegelung des Edinger Rathauses, Dez. 2015
In Memoriam Joy Fleming: Plakat mit einer Spiegelung des Edinger Rathauses, Dez. 2015
 Bild 342
Bild 342
 Künstlicher Weihnachtsmann auf verregnetem Weihnachtsmarkt, Darmstadt 2009.
Künstlicher Weihnachtsmann auf verregnetem Weihnachtsmarkt, Darmstadt 2009. Bild 343
Bild 343
 Diese spiegelnde Fläche ergab sich unerwartet: Ich wollte nur das Abendrot am Ende der Strasse einfangen, und hatte dazu die immer-dabei-Kamera (IXUS 60) auf das recht hohe, noch feuchte Autodach gestellt.
Diese spiegelnde Fläche ergab sich unerwartet: Ich wollte nur das Abendrot am Ende der Strasse einfangen, und hatte dazu die immer-dabei-Kamera (IXUS 60) auf das recht hohe, noch feuchte Autodach gestellt. Bild 343A
Bild 343A
 Das Autodach des Mietwagens war pieksauber, leicht gewölbt und nicht zu hoch, und lud so zu einer kleinen Verfremdung ein. Bryce Canyon, 2004
Das Autodach des Mietwagens war pieksauber, leicht gewölbt und nicht zu hoch, und lud so zu einer kleinen Verfremdung ein. Bryce Canyon, 2004

 Bild 346
Bild 346
 Lag wochenlang im Gras-,
Lag wochenlang im Gras-,





 Weibliche Formen, vervielfacht durch ein spezielles Prismenfilter
(wird sonst bei Videoaufnahmen für Überblendungen benutzt)
Weibliche Formen, vervielfacht durch ein spezielles Prismenfilter
(wird sonst bei Videoaufnahmen für Überblendungen benutzt) Bild 466
Bild 466
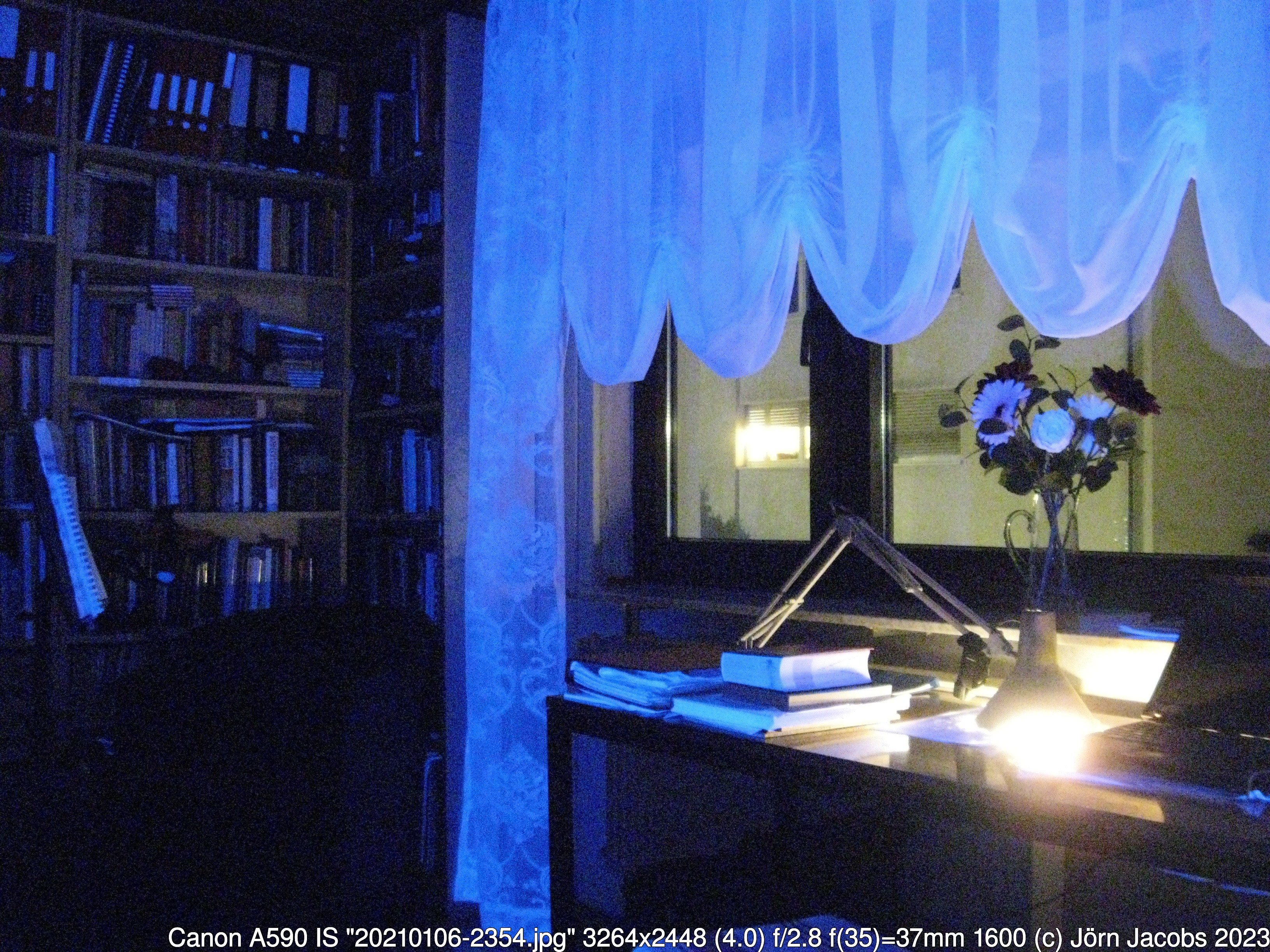 Unten: In einem
dunklen Zimmer regt eine Blaulichtlampe bestimmte Substanzen zum
Leuchten an, z.B. die Aufheller in den Gardinen.
Unten: In einem
dunklen Zimmer regt eine Blaulichtlampe bestimmte Substanzen zum
Leuchten an, z.B. die Aufheller in den Gardinen.
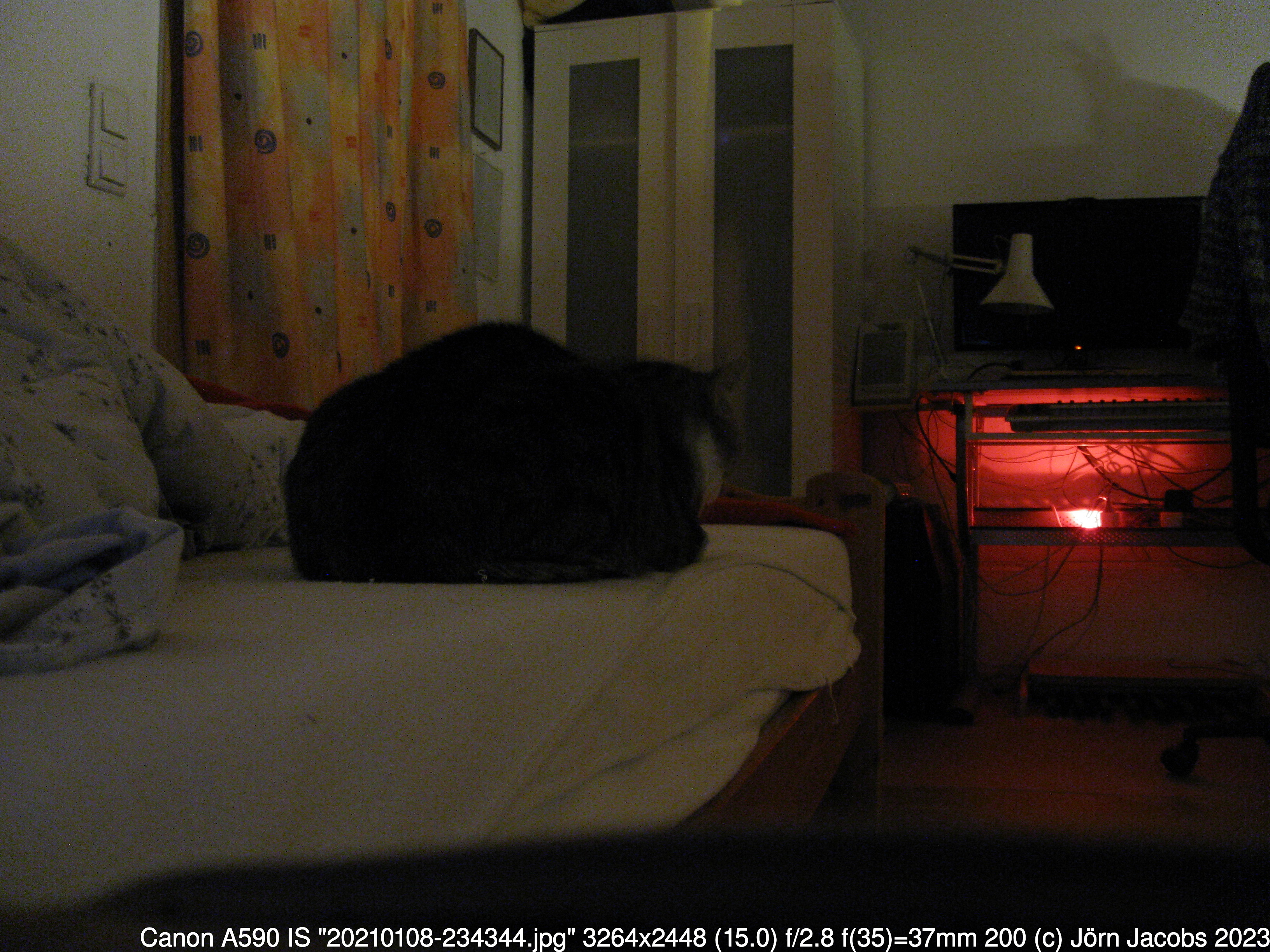 Langzeitbelichtung mit 1 Minute; das Zimmer ist nur spärlich beleuchtet,
eine rote Kontrolleuchte dominiert nun. Die Katze hat sich nicht bewegt,
sie erschiene sonst nur schemenhaft oder wäre unsichtbar.
Langzeitbelichtung mit 1 Minute; das Zimmer ist nur spärlich beleuchtet,
eine rote Kontrolleuchte dominiert nun. Die Katze hat sich nicht bewegt,
sie erschiene sonst nur schemenhaft oder wäre unsichtbar. 
 Wie aber gestaltet man eine Sylvester-Feuerwerksaufnahme, wenn die
""Anzahl der "Knaller" eher gering ist, wie hier in enem eher ruhigen Edinger Wohngebiet? Kamera auf Stativ, chdk-Bewegungserkennung macht über die Zeit dann mehrere Aufnahmen ("was halt so kommt"). Die schönsten werden später herausgesucht, etwas kontrastverstärkt (um das Rauschen in den dunklen Bildpartien zu mildern), dann alle schwarzen Flächen durch Tranzparenz ersetzt, und die Bilder
mit Bildverarbeitung überlagert. Voilà!
Wie aber gestaltet man eine Sylvester-Feuerwerksaufnahme, wenn die
""Anzahl der "Knaller" eher gering ist, wie hier in enem eher ruhigen Edinger Wohngebiet? Kamera auf Stativ, chdk-Bewegungserkennung macht über die Zeit dann mehrere Aufnahmen ("was halt so kommt"). Die schönsten werden später herausgesucht, etwas kontrastverstärkt (um das Rauschen in den dunklen Bildpartien zu mildern), dann alle schwarzen Flächen durch Tranzparenz ersetzt, und die Bilder
mit Bildverarbeitung überlagert. Voilà!  Bild 469
Bild 469


 Bild 471
Bild 471

 />
Bild 473
/>
Bild 473

 Bild 474
Bild 474
 Backen blasen Pusteblume: Kamera Canon PowerShot SX230 HS, 1/250 s, F/5.9, ISO 125 />
Brennweite 70 mm (Tele,(35 mm equivalent: 390.9 mm)); eine Spontanaufnahme aus
grösserer Entfernung. Da viel Licht da war, konnten dank 1/250 s die wegfliegenden
Samen noch eingefangen werden. Sonst hätte man näher dran sein müssen, und wohl den Blitz benutzen.
Backen blasen Pusteblume: Kamera Canon PowerShot SX230 HS, 1/250 s, F/5.9, ISO 125 />
Brennweite 70 mm (Tele,(35 mm equivalent: 390.9 mm)); eine Spontanaufnahme aus
grösserer Entfernung. Da viel Licht da war, konnten dank 1/250 s die wegfliegenden
Samen noch eingefangen werden. Sonst hätte man näher dran sein müssen, und wohl den Blitz benutzen.

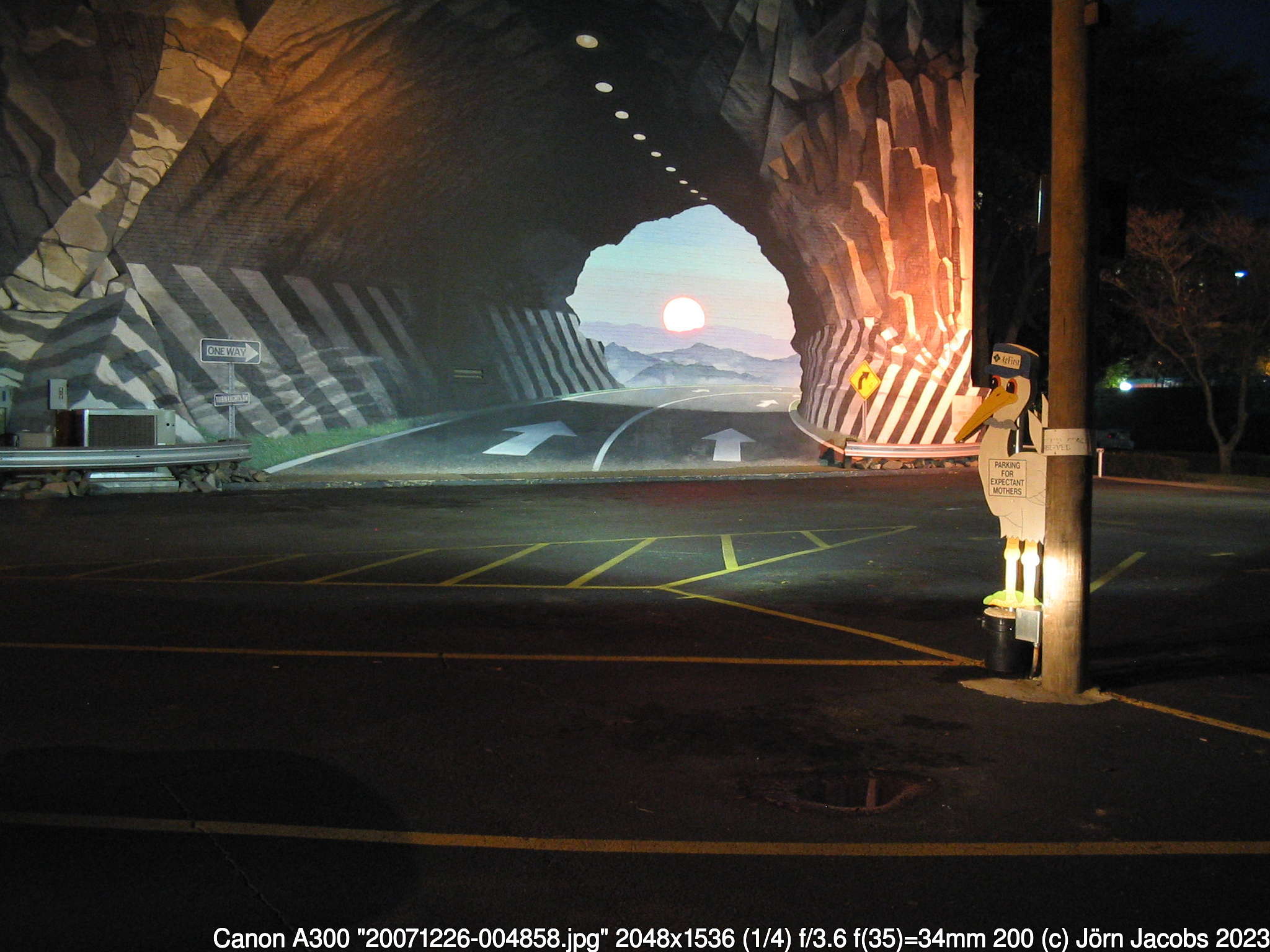 Parkplatz-Erweiterung durch ein Wandgemälde an der Frauenklinik
in
Columbia, S.C., 2007. Der Klapperstorch rechts vorn an der Laterne ist noch im
echten" Bereich, wo auch ich mit der Kamera gestanden habe. Der reale Parkplatz endet
an der gemalten waagerechten Tunneleinfahrtslinie".
Parkplatz-Erweiterung durch ein Wandgemälde an der Frauenklinik
in
Columbia, S.C., 2007. Der Klapperstorch rechts vorn an der Laterne ist noch im
echten" Bereich, wo auch ich mit der Kamera gestanden habe. Der reale Parkplatz endet
an der gemalten waagerechten Tunneleinfahrtslinie".
 Neue Mensa (Cafeteria) der Uni Frankfurt, 1994: Der Saal wurde durch
ein gleichmöbliertes Wandbild mit Promi- und Comic-Publikum optisch
erweitert. Der grosse Tisch vorne im Bild ist noch echt. Ich habe dort
unzählige Male gesessen und gegessen. Dieses Gemälde musste
ich einfach retten! Ob es wohl heute (2021) noch dort zu sehen ist??
Neue Mensa (Cafeteria) der Uni Frankfurt, 1994: Der Saal wurde durch
ein gleichmöbliertes Wandbild mit Promi- und Comic-Publikum optisch
erweitert. Der grosse Tisch vorne im Bild ist noch echt. Ich habe dort
unzählige Male gesessen und gegessen. Dieses Gemälde musste
ich einfach retten! Ob es wohl heute (2021) noch dort zu sehen ist??


 Sonne über der kath. Kirche Edingen, 2015. Durch Verwendung des Filters (Abb. rechts) mit eingeschliffener Rautenstruktur bekam die Sonne, das Spitzenlicht par excellence,
sechs Strahlen.
Bild 479
Sonne über der kath. Kirche Edingen, 2015. Durch Verwendung des Filters (Abb. rechts) mit eingeschliffener Rautenstruktur bekam die Sonne, das Spitzenlicht par excellence,
sechs Strahlen.
Bild 479
 Bild 480
Bild 480 

 Sich über viele Meter abseilende Raupe im Schlosspark Wolfsgarten, 2005.
Sich über viele Meter abseilende Raupe im Schlosspark Wolfsgarten, 2005.
 <
<

 Bild 485
Bild 485
 Im Auto links hat sich der Fahrer versteckt, wohl aus Angst vor einer Gardinenpredigt.
Im Auto rechts bereitet sich der Meister dann hochkonzentriert aufs Rollen vor.
Im Auto links hat sich der Fahrer versteckt, wohl aus Angst vor einer Gardinenpredigt.
Im Auto rechts bereitet sich der Meister dann hochkonzentriert aufs Rollen vor.
 Bild 487
Bild 487

 "Selbstbildnisse"
"Selbstbildnisse" Bild 489
Bild 489

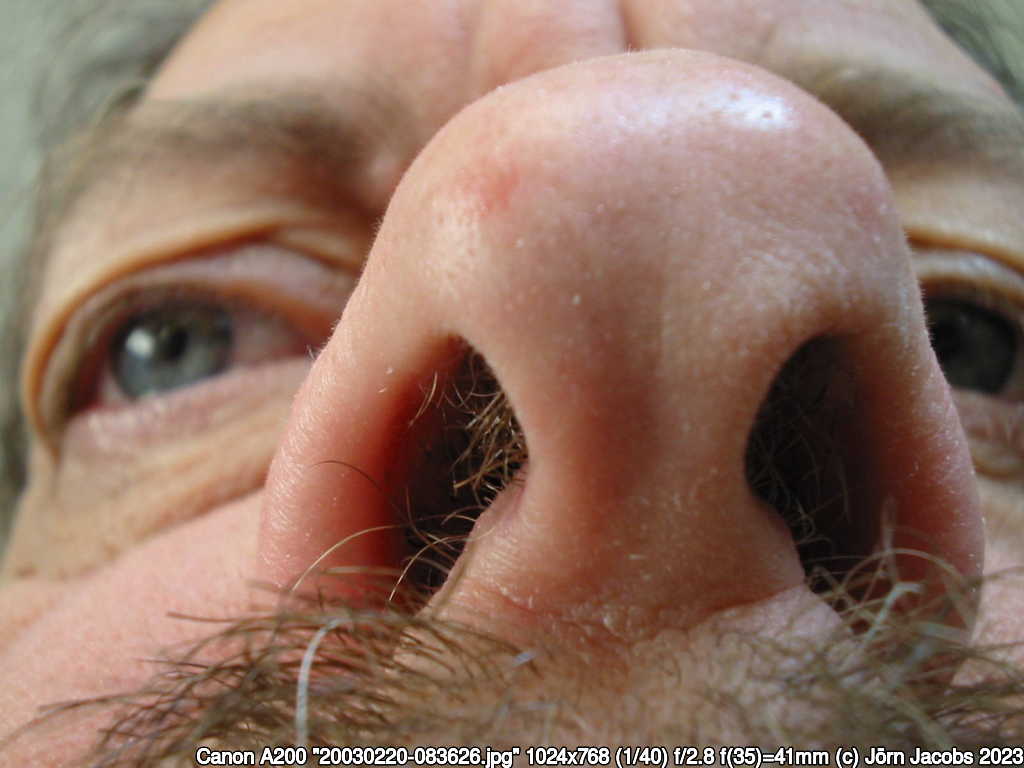

 kommt selten vor, und man braucht einen Spiegel!
(hier ein (Überwachungs?-)Spiegel in einem Supermarkt,
in dem sich meine Digital IXUS 60 ... spiegelt.
Bild 492
kommt selten vor, und man braucht einen Spiegel!
(hier ein (Überwachungs?-)Spiegel in einem Supermarkt,
in dem sich meine Digital IXUS 60 ... spiegelt.
Bild 492

 Zum Vergleich unten der Mond, am 2021:04:19 21:44:55 mit Panasonic DMC-G3 mit Stativ, mit einem festen Teleobjektiv von 300 mm Brennweite, 1/160s, ISO 1600, hier auf gleiche Abbildungsgrösse gebracht: Die Qualität ist durchaus vergleichbar; die Aufnahme vom April leidet u.a. auch an leichtem Dunst in der Erdatmosphäre.
Bild 494
Zum Vergleich unten der Mond, am 2021:04:19 21:44:55 mit Panasonic DMC-G3 mit Stativ, mit einem festen Teleobjektiv von 300 mm Brennweite, 1/160s, ISO 1600, hier auf gleiche Abbildungsgrösse gebracht: Die Qualität ist durchaus vergleichbar; die Aufnahme vom April leidet u.a. auch an leichtem Dunst in der Erdatmosphäre.
Bild 494

 Für Allerweltsfotografie braucht man sie eher selten; für Aufnahmen in der freien Natur aber
recht oft, denn viele Tiere scheuen die Nähe des Menschen.
Das Bild zeigt ein Novoflex Pistolen-Tele 400mm, darunter ein konventionelles
Tele 500mm und schliesslich ein Spiegeltele 500mm (sehr kurz und leicht, aber feste
Blende f/8.0).
Für Allerweltsfotografie braucht man sie eher selten; für Aufnahmen in der freien Natur aber
recht oft, denn viele Tiere scheuen die Nähe des Menschen.
Das Bild zeigt ein Novoflex Pistolen-Tele 400mm, darunter ein konventionelles
Tele 500mm und schliesslich ein Spiegeltele 500mm (sehr kurz und leicht, aber feste
Blende f/8.0).
 mit Erfolg ausprobiert bei Mond-Fotografie).
mit Erfolg ausprobiert bei Mond-Fotografie).

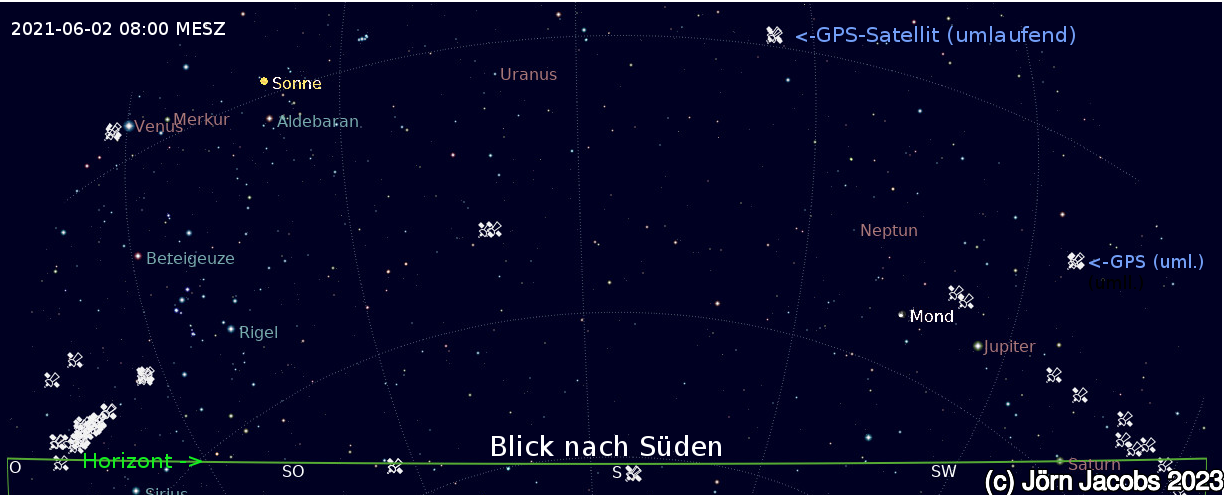 Es ist ein wenig wie bei der Landschaftsmalerei: Manche Dinge lassen sich nur
schwer, und oft überhaupt nicht, abbilden. Die heutige Zeit ist deshalb voll von
Simulationen, und die Menschheit muss lernen, damit umzugehen, was konkret heisst:
Viel fundierte Kenntnis über die realen Dinge, um dadurch immer die konkret vorliegende
Präsentation auf ihre Echtheit und vor allem ihre Relevanz zu prüfen. Das Bild zeigt
(als eine Simulation mittels des Astronomieprogramms
KStar") einen Blick in den Himmel am Tage, von Nord-Baden aus dem Blick
nach Süden gerichtet, ca. 8 Uhr MESZ; Wir sehen abgebildet Sonne und Mond,
dann die wichtigsten Sterne in dem Bereich, zwei (umlaufende) GPS-Satelliten
und eine Unmenge (geostationäre) Telekommunikationssatelliten (besonders links und
rechts am Bildrand, einer in der Mitte). Einen guten ersten Eindruck vom
Geschehen bekommt man damit; aber es ist nur eine Simulation. Die Sterne
sind selbst bei wolkenlosem Himmel am hellichten Tage NIEMALS zu sehen
(Ausnahme: Sonnennahe Planeten während der Dämmerung). Ausserdem: ist das
wirkliche Geschehen VIEL komlizierter, die Zahl der Sterne ist millionenfach
grösser, und die Zahl der Satelliten, die seit gut 60 Jahren "da oben" kreisen,
bestimmt etliche hundert mal grösser als in der Simulation.
Es ist ein wenig wie bei der Landschaftsmalerei: Manche Dinge lassen sich nur
schwer, und oft überhaupt nicht, abbilden. Die heutige Zeit ist deshalb voll von
Simulationen, und die Menschheit muss lernen, damit umzugehen, was konkret heisst:
Viel fundierte Kenntnis über die realen Dinge, um dadurch immer die konkret vorliegende
Präsentation auf ihre Echtheit und vor allem ihre Relevanz zu prüfen. Das Bild zeigt
(als eine Simulation mittels des Astronomieprogramms
KStar") einen Blick in den Himmel am Tage, von Nord-Baden aus dem Blick
nach Süden gerichtet, ca. 8 Uhr MESZ; Wir sehen abgebildet Sonne und Mond,
dann die wichtigsten Sterne in dem Bereich, zwei (umlaufende) GPS-Satelliten
und eine Unmenge (geostationäre) Telekommunikationssatelliten (besonders links und
rechts am Bildrand, einer in der Mitte). Einen guten ersten Eindruck vom
Geschehen bekommt man damit; aber es ist nur eine Simulation. Die Sterne
sind selbst bei wolkenlosem Himmel am hellichten Tage NIEMALS zu sehen
(Ausnahme: Sonnennahe Planeten während der Dämmerung). Ausserdem: ist das
wirkliche Geschehen VIEL komlizierter, die Zahl der Sterne ist millionenfach
grösser, und die Zahl der Satelliten, die seit gut 60 Jahren "da oben" kreisen,
bestimmt etliche hundert mal grösser als in der Simulation.


 "Derselbe Himmel", Kamera horizontal nach Osten gerichtet: EOS M10, ISO 800, 15 sec Belichtungszeit. Rechts oben ist sehr schön das Sternbild Orion zu sehen:
,Bild 499
"Derselbe Himmel", Kamera horizontal nach Osten gerichtet: EOS M10, ISO 800, 15 sec Belichtungszeit. Rechts oben ist sehr schön das Sternbild Orion zu sehen:
,Bild 499


 Superweitwinkelobjektive ("Fisheye") bringen einen Bereich von nahe 180 Grad auf
das Bild, und damit extreme Bildverzerrungen, die aber oft sehr reizvoll und
keineswegs immer störend sind. Es wird generell behauptet (und das stimmt!),
dass die Füsse des Fotografen immer mit auf dem Bild sind...
Superweitwinkelobjektive ("Fisheye") bringen einen Bereich von nahe 180 Grad auf
das Bild, und damit extreme Bildverzerrungen, die aber oft sehr reizvoll und
keineswegs immer störend sind. Es wird generell behauptet (und das stimmt!),
dass die Füsse des Fotografen immer mit auf dem Bild sind... Hier der Beweis:
Unser grüner Balkon. Kamera EOS M10 mit Superweitwinkelobjektiv 8mm, d.h.
ca 12mm effektiv.
Hier der Beweis:
Unser grüner Balkon. Kamera EOS M10 mit Superweitwinkelobjektiv 8mm, d.h.
ca 12mm effektiv.
 "klein,ganz nah" zu "gross, aber weit weg"
werden wie von Zauberhand verbunden.
Bild 503
"klein,ganz nah" zu "gross, aber weit weg"
werden wie von Zauberhand verbunden.
Bild 503
 Ein besonderer Fall ist der gesamte sichtbare Sternenhimmel in einer klaren Nacht: Hier muss die Kamera auf den Rücken gelegt werden, auf eine waagerechte Fläche, so dass möglichst viel Himmel eingefangen wird. Umliegende Gebäude und Bäume werden den Rand der Aufnahme bilden. Dennoch sollte die Kamera möglichst hoch aufgelegt werden. So eine
Aufnahme habe ich noch nicht geschafft. Ich kann aber das Ergebnis eines Vorversuchs mit einer CHDK-gesteuerten A570IS in Zoom-Weitwinkelstellung zeigen:
Daten: ISO-200 3072x2304 (15.0s) f/3.2 f(35)=37mm
Bild 504
Ein besonderer Fall ist der gesamte sichtbare Sternenhimmel in einer klaren Nacht: Hier muss die Kamera auf den Rücken gelegt werden, auf eine waagerechte Fläche, so dass möglichst viel Himmel eingefangen wird. Umliegende Gebäude und Bäume werden den Rand der Aufnahme bilden. Dennoch sollte die Kamera möglichst hoch aufgelegt werden. So eine
Aufnahme habe ich noch nicht geschafft. Ich kann aber das Ergebnis eines Vorversuchs mit einer CHDK-gesteuerten A570IS in Zoom-Weitwinkelstellung zeigen:
Daten: ISO-200 3072x2304 (15.0s) f/3.2 f(35)=37mm
Bild 504
 Die Aufnahme Vom Sternenhimmel zeigt bereits deutlich
diese kleinen Striche, denn die Belichtungszeit betrug ca. 1 Minute. Interessant
sind die beiden längeren. völlig geraden Striche rechts oben. Die rote Farbe
deutet auf die Positionslichter von Flugzeugen hin.
richtige" Aufnahme muss also die Belichtungszeit kürzer sein. Dazu dann die ISO-Einstellung möglichst hoch (1600 oder mehr), was bei einer Wechselobjektiv-Kamera mit ihrem wesentlich grösseren Fotosensor möglich ist. Mal sehen...
Die Aufnahme Vom Sternenhimmel zeigt bereits deutlich
diese kleinen Striche, denn die Belichtungszeit betrug ca. 1 Minute. Interessant
sind die beiden längeren. völlig geraden Striche rechts oben. Die rote Farbe
deutet auf die Positionslichter von Flugzeugen hin.
richtige" Aufnahme muss also die Belichtungszeit kürzer sein. Dazu dann die ISO-Einstellung möglichst hoch (1600 oder mehr), was bei einer Wechselobjektiv-Kamera mit ihrem wesentlich grösseren Fotosensor möglich ist. Mal sehen...
 Diese Vorsätze lassen sich sogar auch bei einigen Taschenkameras verwenden,
allerdings nur, wenn man einen passenden Adaptertubus hat. Hier eine
A570IS mit riesigem Televorsatz (Weitwinkel gibt's auch), der
nicht allzuviel bringt, aber auch nicht viel kostet.
Diese Vorsätze lassen sich sogar auch bei einigen Taschenkameras verwenden,
allerdings nur, wenn man einen passenden Adaptertubus hat. Hier eine
A570IS mit riesigem Televorsatz (Weitwinkel gibt's auch), der
nicht allzuviel bringt, aber auch nicht viel kostet.